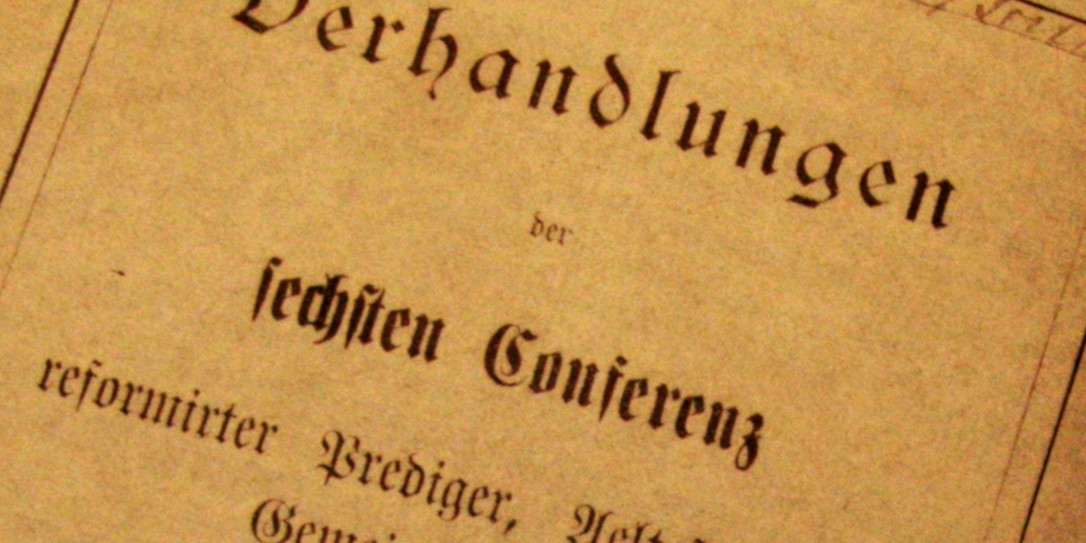Wichtige Marksteine
Reformierte im Spiegel der Zeit
Geschichte des Reformierten Bunds
Geschichte der Gemeinden
Geschichte der Regionen
Geschichte der Kirchen
Biografien A bis Z
(1528–1572)
Jeanne d´Albret (1528–1572) war die bedeutendste Frau in der Geschichte der Hugenotten im 16. Jahrhundert. Besonders in ihrem Witwenstand, in den letzten zehn Jahren ihres Lebens, baute sie eine reformierte Kirche in Béarn auf und war das politische Oberhaupt der Hugenotten im dritten Religionskrieg (1568–1570). Nach 1570 versuchte sie, die Reformierten zu schützen und ihnen einen gesicherten Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. Sie handelte für die Hugenotten den Friedensschluss von St. Germain 1570 aus, und durch die Heirat ihres Sohnes Heinrich (später Heinrich IV. von Frankreich) mit Margarete von Valois, Schwester des Königs Karl IX. von Frankreich, strebte sie eine enge Verbindung von Hugenotten und Katholiken an.
Keine andere Frau hatte eine solche Machtposition unter den Hugenotten in Frankreich inne. Sie war respektiert und gefürchtet in Rom und Madrid, alliiert mit Elizabeth von England und befreundet mit Katharina von Medici – keine unkomplizierte Freundschaft zwischen zwei starke Frauen.
Sie sorgte dafür, dass ihre Kinder – Heinrich und Katharina – im reformierten Glauben erzogen wurden. Jahrelang kämpfte Heinrich als Anführer der Hugenotten und von einer Machtbasis in Südfrankreich aus um die französische Krone, bis er 1589 König von Frankreich wurde und schließlich 1593 zum katholischen Glauben übertrat, um das Land zu befrieden.
Jeanne d´Albret war nicht nur Mutter ihres berühmten Sohnes, sie war auch selbst eine machtvolle Frau in Frankreich, da ihre Position als Anführerin der Hugenotten ihr einen Einfluss weit über die Grenzen ihres kleinen Königreiches zusicherte.
Jugend und Ehe (1528-1555)
Jeanne d´Albret wurde am 7. November 1528 auf dem Schloss Blois von Margarete und Heinrich II. von Navarra geboren. Ihre Mutter wusste angeblich, dass sie eine Tochter gebären würde, ihr sehnlichster Wunsch war freilich nach einem Sohn. Jeanne blieb das einzige Kind aus dieser Ehe, Margarete von Navarra gebar zwar kurz danach einen Sohn, der als Kleinkind starb, und alle übrigen Hoffnungen auf Schwangerschaften zerschlugen sich.
Die kleine Prinzessin konnte von ihrem Vater das Königreich Navarra erben, weil dort das salische Gesetz, das in Frankreich weibliche Thronerben verbot, nicht gültig war. Außerdem war das vicomté Béarn selbständig. Deswegen waren die zwei Großmächte Spanien und Frankreich zutiefst an diesen Grenzregionen interessiert. Frankreich wollte seine Südgrenze verteidigen, und Spanien beide Seiten der Pyrenäen besitzen, um in Frankreich einfallen zu können. Zudem war die väterliche Familie von Albret Großgrundbesitzer in Südwestfrankreich und damit Vasall des französischen Königs. Das frühere Aquitanien hatte mehrere hundert Jahre der englischen Krone gehört und war spät von England aufgegeben worden. Im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet meistens als Guyenne bezeichnet.
In ihren jungen Jahren wuchs Jeanne in der Normandie auf. Ihre Mutter, Margarete von Navarra, hatte die Aufgabe, die königlichen Kinder ihres Bruders, Franz I., zu erziehen. Sie gab Jeanne in die Obhut ihrer Freundin Aymée de Lafayette, Vogtin von Caen. Man behauptet, sie sei die Vorlage für die Figur Longarine in Heptameron (vgl. Nielsen). Nach meiner Auffassung sind die Erzähler/innen im Heptameron, die sogenannten devisants, eher Typen als historische Persönlichkeiten, die Figur der Longarine ist allerdings eine sehr sympathische Frau mit Humor und Pfiff. Wenn Aymée de Lafayette die Vorlage zu Longarine abgegeben haben soll, deutet alles darauf hin, dass Margarete sie sehr schätzte und meinte, ihre Tochter sei bei ihr gut aufgehoben.
Jeanne wuchs in einem landadligen Milieu auf, umgeben von Wald, Wiesen und Tieren, mit den Mitgliedern der Familie von Aymée de Lafayette als Bezugspersonen, bis sie zehn Jahre alt war. Ihre Mutter sah sie selten, aber jedes Mal, wenn sie krank war, war Margarete sofort zur Stelle. 1538 ließ Franz I. sie nach Plessis-lez-Tours bei der Loire übersiedeln, da sie jetzt ein Alter erreicht hatte, wo sie auf dem Heiratsmarkt von Interesse war. Der König konnte über seine Verwandte entscheiden und Ehen arrangieren, wie es ihm passte.
1540 war es für Jeanne so weit. Herzog Wilhelm der Reiche von Kleve-Jülich-Berg hatte 1538 das Herzogtum Geldern geerbt. Sein Erbanspruch wurde von Kaiser Karl V. angefochten und auf dem Reichstag zu Regensburg wurde dem Kaiser Geldern zugeteilt. 1539 folgte Wilhelm seinem Vater auf dem Thron nach, und um sich vor den Ansprüchen des Kaisers zu schützen, arrangierte er eine Ehe mit Heinrich VIII. von England für seine Schwester Anna, und selbst verbündete er sich mit Franz I. Als Unterpfand für dieses Bündnis sollte er Jeanne d´Albret heiraten.
Was jetzt passierte, ist absolut ungewöhnlich: Jeanne weigerte sich. Die Zwölfjährige ließ ihrem Onkel wissen, dass sie den Herzog nicht heiraten möchte, und sie ließ zwei Schreiben aufsetzen, in welchen sie erklärte, dass sie gegen ihren Willen zu dieser Ehe gezwungen worden sei. Natürlich konnte sie sich nicht auf Dauer gegen den Willen des Königs auflehnen, aber bei der Hochzeitszeremonie am 14. Juni 1541 weigerte sie sich, zum Altar zu schreiten, stattdessen musste sie getragen werden. Ihr Jawort war nicht hörbar und wegen ihres Alters wurde die Ehe nicht vollzogen, der Herzog setzte nur symbolisch ein Bein in ihr Bett. Nach der Hochzeit kehrte er zurück nach Düsseldorf, während Jeanne vorläufig in Frankreich blieb.
1543 griff Kaiser Karl Kleve-Jülich-Berg an, der Herzog wurde geschlagen und musste Geldern Karl V. überlassen. Am Frieden von Venlo im September 1543 hob er das Bündnis mit Franz I. auf und verbündete sich stattdessen mit dem Kaiser. Damit war auch die französische Ehe hinfällig geworden, 1545 wurde sie vom Papst wegen Nichtvollzug annulliert, und der Herzog vermählte sich mit einer Nichte des Kaisers.
Nach kanonischem Recht durfte bei einer Eheschließung keine Zwang im Spiel sei. Die Eheleute mussten ihr Gelübde frei abgeben. Damals konnten junge Frauen aus adligen oder königlichen Familien sich ihre Ehepartner nicht selbst aussuchen, sondern wurden als politische Garanten vermählt, und die meisten fanden sich damit ab, weil das ihr Standesbild entsprach. Jeannes Ablehnung, so wie ihre Kenntnis des kanonischen Rechts, ist erklärungsbedürftig.
Eine mögliche Erklärung ist, dass ihre Eltern für sie eine Ehe mit dem Kronprinzen Philipp von Spanien anstrebten. Königin von Spanien war natürlich prestigeträchtiger als Herzogin von Kleve zu sein, aber vor allem erhoffte sich ihr Vater damit den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. 1512 hatten die Spanier Navarra, das Baskenland, bis zu den Pyrenäen erobert und den Albrets nur das winzige Gebiet auf der französischen Seite gelassen. Seitdem überlegten sich die Könige von Navarra, wie sie zu ihrem ganzen Erbe kommen konnten, und eine Ehe zwischen dem Infanten von Spanien und der zukünftigen Königin von Navarra würde genau dies herbeiführen.
Jeanne war möglicherweise auch beeinflusst von einer Erklärung der Ständeversammlung von Béarn, die eine auswärtige Ehe für ihre Kronprinzessin ablehnte.
Sah Jeanne d´Albret ihre Zukunft gefährdet durch eine Ehe mit dem Herzog von Kleve? Oder tat sie, was ihre Eltern wünschten, statt des Königs Willen zu erfüllen? Stammten ihre Kenntnisse des kanonischen Rechts von denen? Margareta von Navarra schrieb ihrem Bruder, sie habe keine Ahnung, was in das Mädchen gefahren sei, aber stimmt das? Hat sie Jeanne mit ihrer Ablehnung der Ehe geholfen aus Liebe (Cholakian & Cholakian), oder aus Ehrgeiz? Es besteht kein Zweifel, dass königliche Kinder damals frühreif waren und in jungen Jahren schon an ihre späteren Aufgaben geführt wurden, trotzdem ist die Zähigkeit und Sturheit des Mädchens erstaunlich.
1547 starb Franz I. und als Jeanne zwanzig Jahre alt war, bot der Nachfolger, Heinrich II. von Frankreich, ihr gleich zwei Heiratskandidaten an: den Herzog Franz von Aumale (der spätere erzkatholische Herzog Franz von Guise) und Anton von Bourbon, Herzog von Vendôme. Der letztere war Erbprinz und vielleicht deshalb für Jeanne die bessere Partie, obwohl er relativ arm war. Er war hochgewachsen – was für einen Bourbon eher selten war – und charmant, wie alle Männer in seiner Familie scheint er ein unverbesserlicher Schürzenjäger gewesen zu sein. Heinrich IV. von Frankreich, der vert galant, hatte seine ausgelebte Sexualität nicht von Fremden, ebenso wenig wie sein militärisches Können und seinen Mut.
Jeanne und Anton von Bourbon heirateten 1548 und sie war überglücklich. Heinrich II. schrieb in einem Brief, dass er selten eine Braut erlebt habe, die immer nur lachte. Diese Ehe war aus Liebe geschlossen, und Anton von Bourbon nahm seine Frau mit, als er in den Krieg zog. Der Kriegsschauplatz war Flandern, und da der Herzog Güter in Nordfrankreich besaß, zog Jeanne in den ersten Jahren ihrer Ehe von Schloss zu Schloss, immer in der Hoffnung, dass sie und Anton von Bourbon sich treffen könnten.
1551 gebar sie ihren ersten Sohn und gab ihn an Aymée de Lafayette, die sie selbst erzogen hatte. Ob nun Frau de Lafayette alt oder übervorsichtig geworden war, der kleine Herzog von Beaumont starb als Kleinkind, angeblich weil er von Wärme erstickt worden sei.
Bald wurde Jeanne wieder schwanger, und während ihr ältester Sohn in Nordfrankreich geboren war, sollte das zweite Kind in Béarn zu Welt kommen. Sie unternahm die lange Reise nach Süden und kam gerade rechtzeitig in Pau an, 14 Tage bevor sie von ihrem zweiten Sohn, Heinrich, auf dem Schloss in Pau entbunden wurde. Es wurde entschieden, dass dieser Junge in Pau bleiben sollte. Der Großvater, Heinrich d´Albret, wollte wahrscheinlich mit diesem kleinen Prinzen die Erbfolge in Béarn und Navarra sichern. Die Legenden von der rauen Erziehung Heinrichs seitens des Großvaters können jedoch nicht wahr sein, allein weil das Kind die ersten Jahre von Ammen betreut wurde, und der Großvater starb, als es zwei Jahre alt war. Es scheint in Béarn Sitte gewesen zu sein, die Lippen des Täuflings mit Rotwein und Knoblauch einzureiben, eine Taufe à la Gascogne, aber die Mär, dass Heinrich barfuß unter den Hirten in den Bergen aufgewachsen sein soll, ist reine Legende. Der spätere Hauslehrer Heinrichs, Palma Cayet, schrieb, als Heinrich schon König von Frankreich war, seine Biographie, und daher stammt der Bericht vom Opa und von seiner rauen Erziehung. Dieser Kindheitsbericht ist eher Propaganda des Königs, wie er gerne gesehen werden möchte.
Tatsächlich kam Heinrich in die Obhut der Familie de Miossens, die auf dem Schloss Coarraze wohnte. Die Frau, Suzanne de Bourbon-Miossens, war eine Cousine von Jeanne. Heinrich wurde demnach genau wie seine Mutter als Landadliger erzogen, und er wuchs in einer Familie mit anderen Söhnen auf, die als Erwachsene seine Gefolgsleute werden sollten. Als seine Mutter den Thron erbte, wurde er schon als Kleinkind als Kronprinz behandelt.
Die zwei Jahre zwischen Heinrichs Geburt 1553 und ihre Thronbesteigung 1555 verbrachte Jeanne wiederum in Nordfrankreich in der Nähe ihres Gatten. In dieser Zeit gebar sie einen dritten Jungen, der jedoch nicht lange lebte. Es muss hinzugefügt werden, dass Anton von Bourbon 1554 einen außerehelichen Sohn, Karl von Bourbon, mit einer Hofdame bekam. Jeanne hatte bereits mehrere Onkel, die illegitim waren, und sie scheint den kleinen Karl in ihrer Familie aufgenommen zu haben. Er wurde später Erzbischof von Rouen.
Erst als der Vater gestorben war, zog sie als Königin nach Pau und obwohl sie die Erbin war, ließ sich ihr Mann als König huldigen, was die Ständeversammlung eigentlich gar nicht wollte, dennoch ordneten sie sich dem Willen Jeannes unter.
Königin an der Seite von Anton von Bourbon (1555–1560)
Ihr Vater hatte Jeanne ein blühendes Land hinterlassen. Er hatte Industrien nach Béarn geholt, das Steuersystem effektiv gestaltet und für den religiösen Frieden gesorgt. Große Einkünfte entstanden auch durch seine Posten als Gouverneur und Admiral der französischen Krone in Guyenne. Anton von Bourbon bekam diese Posten nach seinem verstorbenen Schwiegervater, und später hat sein Sohn, Heinrich von Navarra, sie übernommen. Jeanne und Antoine standen als die größten Grundbesitzer Südwestfrankreichs finanziell sehr gut da.
1555 find Calvin seine missionarische Tätigkeit in Frankreich an. Reformierte gab es in Südwestfrankreich zu diesem Zeitpunkt längst, weil Margareta von Navarra sie mit Predigern unterstützt hatte und Gérard Roussel, einen Reformkatholiken, als Bischof in Orthez, eingesetzt hatte. Dieser Roussel war einmal Weggefährte Calvins gewesen, und dieser warf ihm vor, nicht konsequent genug zu sein, als er die Stelle als katholischer Bischof trotz seiner reformatorischen Sympathien annahm (CStA I,1).
Als Königin hatte Jeanne bei ihrer Krönung versprechen müssen, die katholische Religion zu verteidigen. Am selben Tag, nachdem sie diesen feierlichen Eid abgelegt hatte, schrieb sie an einen Vasallen, dem vicomte von Gourdon, und erzählte ihm, sie wolle über die Förderung des reformierten Glaubens im kleinem Kreis heimlich beraten. Dieser Brief ist Teil eines Briefwechsels mit zwei vicomtes de Gourdon, Vater und Sohn, die die gesamte Regierungszeit Jeannes überdauerte. Die Briefsammlung wurde im vorigen Jahrhundert entdeckt und gibt viele neue Einsichten in die Vorhaben und die Beweggründe Jeannes. Da die entdeckten Briefe uns nur als teilweise fehlerhafte Kopien vorliegen, haben viele Forscher die Briefe als Fälschungen abgetan (Text und Diskussion bei Bryson).
Der erste Brief vom August 1555 teilt uns mit, dass Jeanne schon zu diesem Zeitpunkt reformierte Sympathien deutlich aussprach. Sie schrieb dem vicomte, dass ihre Mutter sich zwischen den zwei Religionen nicht habe entscheiden können, und dass sie selbst aus Furcht vor ihrem Vater bislang nicht gewagt habe, sich offen zum Protestantismus zu bekennen. Das Edikt von Chateaubriant von 1551 verbot eindeutig jede „Ketzerei“ und deshalb schlug sie vor, die Reformierten sollten sich heimlich auf dem Schloss Odos treffen.
Es gibt sonst keine Quellen, die belegen könnten, dass Jeanne mit dem reformierten Glauben in Berührung kam. Es gab in ganz Frankreich zu der Zeit kleine zerstreute Gemeinden, sowie Prediger und Kolporteure, die reformatorische Bücher schmuggelten. Die wiederholten Verbote des Königs konnten das nicht unterbinden, sie führten nur dazu, dass Protestanten, wie Jeanne, sich heimlich treffen mussten.
In den Jahren nach 1555 verbreitete sich der reformierte Glaube mehr und mehr im Hochadel. Auch Anton von Bourbon wurde davon ergriffen, brachte reformierte Prediger nach Béarn und als er und Jeanne 1558 mit Heinrich nach Paris zogen, nahm er an großen psalmensingenden Demonstrationen außerhalb der Stadtmauern von Paris teil. Calvin war darüber hoch erfreut, denn er setzte in seiner Missionsarbeit gerne auf hochrangige Persönlichkeiten. Jeanne dagegen verhielt sich während dieser Zeit bedeckt.
In Paris kam sie mit ihrem vierten Kind, einer Tochter namens Katharina, nieder. Das kleine Mädchen war das einzige Kind, das bei Jeanne aufwachsen durfte, obwohl sie (natürlich) Erzieherinnen und Gouvernanten hatte.
Anton von Bourbon fiel nicht nur mit protestantischen Sympathien auf, sondern wie sein Schwiegervater versuchte er, den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. Heinrich d´Albret hatte seinen Besitz gut und gewinnbringend regiert, während Anton von Bourbon seiner Frau die Regierungsgeschäfte überließ, und selbst nur versuchte, ein größeres Königsreich für sich zu gewinnen. So konnte der spanische König Philipp ihm einen Tausch, erst mit dem Herzogtum Milano und später mit Sardinien, anbieten. Damit hätte Spanien den Sprung über die Pyrenäen geschafft und Südfrankreich bedrohen können. Wir würden solches Taktieren mit dem Feind Hochverrat nennen, damals räumte man freilich Adligen große Freiheiten ein, sich einen Herren auszusuchen, aber Anton von Bourbon wurde auch von den Zeitgenossen als unzuverlässig und unverantwortlich angesehen, und nicht zuletzt war er so politisch ungeschickt, dass es an Dummheit grenzte (Sutherland 1984).
Im Sommer 1559 starb Heinrich II. von Frankreich unerwartet. Sein Sohn Franz II. folgte ihm als nur fünfzehnjähriger Knabe auf dem Thron. In dieser Situation war die traditionelle Lösung, dass der erste erwachsene Erbprinz, Anton von Bourbon, ihn unterstützen sollte, und Calvin ermahnte ihn eindringlich, dieses Amt zu übernehmen und dabei den Hugenotten zu helfen. Anton von Bourbon verspielte diese Chance und überließ die Regierungsgeschäfte der Familie von Guise, besonders dem Herzog von Guise und dem Kardinal von Lorraine, die beide die antiketzerische Politik des verstorbenen Königs weiterführen wollten. Nach dem Tod Heinrichs II. bekannten sich mehrere hochrangige Adlige offen zum Protestantismus und es gab im März 1560 sogar einen hugenottischen Komplott, den König zu entführen und von seinen „schlechten Ratgebern“ zu trennen. Anton von Bourbon und sein jüngerer Bruder, der Prinz von Condé, beide notorische Reformierte, wurden wegen diesem Angriff auf den König angeklagt. Anton von Bourbon versprach Besserung, während sein Bruder, der Prinz Ludwig von Condé zum Tode verurteilt wurde. Nur der plötzliche Tod des jungen Königs rettete ihn vor der Hinrichtung. Da der neue König, Karl IX., ein zehnjähriges Kind war, brauchte Frankreich einen Regenten, nämlich den ranghöchsten Erbprinz Anton von Bourbon. Wiederum ergriff dieser nicht die Chance. Katharina von Medici ließ sich stattdessen als Regentin einsetzen und Anton von Bourbon wurde zum Generalstatthalter ernannt. Die Hugenotten mit Calvin an der Spitze waren zutiefst enttäuscht. In diesen Jahren hatte der reformierte Glaube großen Zulauf, es wurde von mehreren Tausend Gottesdienstbesuchern überall in Frankreich berichtet, von Abendmahlgottesdiensten, die zwei Tage dauerten und von Bekehrungen am Hof und im Hochadel.
1560 verließ Jeanne Paris, um zurück nach Pau zu fahren. Theodorus Beza, der engste Mitarbeiter Calvins, besuchte sie dort, und es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit, die bis Jeannes Tod dauerte. Beza versorgte sie mit Predigern und Beratern für ihr Land. Im Dezember 1560 unternahm Jeanne den entscheidenden Schritt und bekehrte sich öffentlich zum reformierten Glauben. Während ihr Gatte nicht in der Lage war, sich an die Spitze der Hugenotten zu setzen, wurde sie jetzt die leitende Hugenottin in Frankreich.
Reformierte Königin (1560–1568)
Jeanne d´Albret war zweifelsohne eine tief religiöse Frau. Lange Zeit hatte sie äußerste Diskretion walten lassen, zwar mit ihrem Gatten reformierte Prediger gehört, aber sich niemals offen zum reformierten Glauben bekannt. Erst nachdem Anton von Bourbon sich mit dem Posten als lieutenant générale abgefunden hatte, kam sie aus der Deckung.
Es war eine Zeit, wo alle große Hoffnungen bzw. Ängste für den Protestantismus in Frankreich hegten. Drei wichtige Katholiken – der Herzog von Guise, der Konstabel von Montmorency und der Marschall St. André – schlossen sich zusammen, um Frankreich gegen die Reformierten zu schützen. Sie planten den Sturz von Anton von Bourbon und einen Angriff auf Genf mit der Hilfe des Herzogs von Savoyen, zu dessen Besitz Genf bis 1534 gehört hatte. Dieses Triumvirat war der erste Vorbote der katholischen Liga, die später Heinrich IV. hartnäckig bekämpfte (Sutherland 1973).
1560 war noch zu erwarten, dass der Protestantismus nach Frankreich gekommen war, um zu bleiben. Jeanne war sich sehr bewusst, welche Gefahren ihr von Spanien, vom Papst und von der mächtigen Familie von Guise drohten. Sie hatte noch die Hoffnung, dass der junge König Karl IX., Katharina von Medici und ihr Kanzler, der tolerante Michel de l´Hôpital, die Reformierten unterstützen würden, zumal die Königinmutter sich selbst von denen von Guise bedrängt fühlte.
Diese letzte Hoffnung erwies sich als trügerisch, aber niemals wich Jeanne später vom einmal eingeschlagenen Kurs ab. Sie konnte weder geldwerte Vorteile noch politisches Kapital aus ihren Glauben schlagen, dafür hielt sie konsequent an ihrer Überzeugung fest.
In Béarn machte sie erste vorsichtige Schritte, um das Land zu reformieren. Es gab schon Reformierte dort, und Prediger hatten angefangen, den neuen Glauben zu verbreiten, Jeanne aber träumte von einem reformierten Land, und fing langsam und vorsichtig an, diesen Traum zu verwirklichen.
Der erste Schritt war, den reformierten Glauben dem Katholizismus rechtlich gleich zu stellen. Die Kirchen wurden für beide Religionen geöffnet (das sogenannte simultaneum) und aus den Kirchen in Lescar und Pau wurden Bilder und Statuen entfernt, allerdings nicht in Form eines Bildersturms, sondern von den Behörden. Jeanne beschlagnahmte das kirchliche Vermögen nicht für sich selbst, sondern investierte es in Sozialfürsorge und Bildung.
Es ist klar, dass sie den reformierten Glauben einführen wollte, aber zu keinem Zeitpunkt vefolgte sie Andersgläubige, geschweige denn verbrannte sie. Immer setzte sie auf Überredung.
Im August 1561 begab sie sich wieder zum Hof. Überall wurde sie stürmisch von Hugenotten begrüßt, als ob sie „der Messias sei“, bemerkte verärgert der spanische Gesandte. Katharina von Medici hatte zu einem Religionsgespräch eingeladen. Dieses Gespräch fand in Poissy außerhalb Paris statt. Seitens der Krone war gewiss an eine Versöhnung oder gar einen Ausgleich zwischen den Religionen gedacht, die reformierten Teilnehmer mit Beza an der Spitze mochten jedoch keine Kompromisse eingehen. Beza wurde unterstützt von Calvin in Genf, der selbst zu krank war, um mitzukommen. Calvin war mit den Auftritten und Reden Bezas zufrieden, während z.B. der Admiral Coligny Beza als reichlich provokant wahrnahm.
Im Herbst 1562 blieb Jeanne mit ihren Kindern beim Hofe. Katharina von Medici suchte auch nach den Religionsgesprächen eine Übereinkunft mit den Protestanten, was in dem Edikt vom 17. Januar 1562 – auch Edikt von St. Germain genannt – gipfelte. Dieses Edikt, an dem der Kanzler Michel de l´Hôpital und Beza beteiligt waren, erlaubte es den Hugenotten, außerhalb der Städte Gottesdienste zu halten. Es war das günstigste Edikt, das sie jemals erlangen sollten, das Edikt von Nantes 1598 war ihm sehr ähnlich, aber nicht ganz so großzügig. Der Unterschied war, dass Heinrich IV. dafür sorgte, dass das Edikt von Nantes durchgeführt wurde, während alle frühere Edikte, so wohlgemeint sie auf dem Papier auch waren, von katholischen Behörden unterlaufen wurden, und der König zu schwach war, um für ihre Durchführung zu sorgen.
Im März 1562 massakrierte der Herzog von Guise eine reformierte Gemeinde, die innerhalb des Städtchens Wassy Gottesdienst feierte. Damit war die Versöhnungspolitik Katharinas von Medici gescheitert. Die Hugenotten unter dem Prinzen von Condé griffen zu den Waffen und Anton von Bourbon bat Jeanne den Hof zu verlassen. Er behielt seinen Sohn Heinrich bei sich, entließ aber dessen hugenottischen Hauslehrer. Jeanne beschwor ihren Sohn, nicht zur Messe zu gehen, und der junge Prinz hielt sich wohl auch ein paar Wochen daran, musste sich aber schließlich fügen. Nach ihrem Fortgang vom Hofe trat Jeanne eine monatelange abenteuerliche Reise durch Frankreich an, so gefährlich, dass die ersten Briefen von der Hand Heinrichs seine Ängste um seine Mutter bezeugen. Ihre kleine Tochter Katharina durfte sie behalten.
Im ersten Religionskrieg führte Anton von Bourbon die königlichen katholischen Truppen gegen die Hugenotten. Bei der Belagerung von Rouen wurde er verwundet und starb am 17. November. Der junge Heinrich blieb am Hofe in der Obhut Katharinas von Medici, die allerdings Jeanne gestattete, ihm wieder reformierte Hauslehrer zu geben. Sie sollte ihn erst 1564 wiedersehen.
Die Kirche in Béarn und Navarra
Ihre große Aufgabe sah Jeanne darin, die Reformation in Béarn durchzuführen.
Calvin stellte ihr Jean Raymond Merlin zur Seite, den früheren Professor für Hebräisch in Lausanne, wo er Kollege von Beza, dem Professor für Griechisch, und von Pierre Viret, dem Rektor der Akademie, gewesen war. Pierre Viret arbeitete nach seiner Zeit in Lausanne und Genf vor allem in Frankreich, besonders in den Kirchen von Lyons und Nîmes. Später sollte er für Jeanne d´Albret ihre Akademie in Orthez aufbauen. Merlin war übrigens mit einer Tochter von Marie Dentière verheiratet, derjenigen, die vor Jahren Jeanne eine selbstgeschriebene hebräische Grammatik zugesandt hatte (vgl. Graesslé13f.; Nielsen).
Merlin ging voll Eifer an die Aufgabe, eine reformierte Kirche in Béarn aufzubauen. Es gab viele Reformierte in Südfrankreich, aber meistens unter städtischen Eliten und Handwerkern. Die Reformierten waren meistens des Lesens fähig, vor allem des Lesen französischer Texte. In Südwestfrankreich sprach die Bevölkerung die langue d´oc, die alte oczitanische Sprache, in irgendeiner Form. Die Gascogne hatte ihre Sprache, in der ein Neues Testament und fünfzig Psalmen übersetzt wurden, und Béarn hatte béarnais sogar als Amtssprache. Hinzu kam, dass die Bevölkerung in Navarra Baskisch sprach. Wenn Merlin das ganze Land reformieren sollte, musste er diese Sprachbarrieren überwinden, denn die Landbevölkerung musste erreicht und für die Reformation gewonnen werden.
Jeanne d´Albret beauftragte eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Baskische, und eine Übertragung der Psalmen, der Zehn Gebote, der Liturgie und des Katechismus Calvins in die Sprache Béarns. Der Anwalt, später Pastor, Arnaud de la Salette, stellte 1571 diese Übersetzung fertig, und obwohl sie erst 1583 gedruckt wurde, darf man annehmen, dass in der Zwischenzeit Manuskriptkopien verwendet wurden. Pastoren, die die béarnesische oder die baskische Sprache beherrschten, wurde händeringend gesucht, und von den Anderen wurde ausdrücklich verlangt, dass sie es lernen sollten. Katecheten, die vermutlich Landeskinder waren, wurden in die Gemeinden geschickt.
Allmählich verbot Jeanne katholische Riten und Gebräuche, zuerst die Fronleichnamsprozessionen, danach Maibäume und Jahrmärkte. Dann wurde die Messe abgeschafft. Der Dom von Lescar und die Kirche St. Martin in Pau wurden leergeräumt, und die dort befindlichen Schätze verkauft.
Für Merlin konnte dies nicht schnell genug gehen. In seinen Briefen an Calvin klagte er seine Not: die Bevölkerung sei stur – diese Holzköpfe! - und die Königin zu langsam und vorsichtig (CO 20, Nr. 3988 & Nr. 4061). Merlin hatte übrigens auch früher in Montargis Probleme mit Renée de France gehabt, Herzogin von Ferrara, die in ihrem Gebiet so vorsichtig war wie Jeanne in Béarn (vgl. Lambin, 2). Jeanne bekam Klagen auf der jährlichen Ständeversammlung, wo die Katholiken über den Verlust alter Freiheiten und Rechte klagten. In den sechziger Jahren musste sie mehrmals Aufstände niederschlagen.
Der Nachfolger für Merlin war Pierre Viret, der enge Freund Calvins. Er war Pastor und Rektor für die Akademie in Lausanne – mit Beza und Merlin als Kollegen – gewesen. Wegen eines Streits mit dem Stadtrat in Bern, übersiedelten 1559 alle Professoren nach Genf, um dort in der neu errichteten Akademie zu unterrichten. Von Genf begab Viret sich nach Frankreich, wo er in Lyon als Pastor arbeitete, danach leitete er die Nationalsynode in Nîmes und schließlich folgte er dem Ruf nach Béarn. Seine wesentlichste Aufgabe war es, die Akademie in Orthez aufzubauen. Die Fächer Theologie, Hebräisch, Griechisch, Philosophie und Mathematik wurden dort unterrichtet, während es keine Anzeigen für Professuren in Jura und Medizin gibt.
Vor ihrer akademischen Laufbahn absolvierten die Jungen eine fünfjährigen Ausbildung in einer Lateinschule (collège), während die Grundschule sowohl Jungen wie Mädchen unterrichtete, die Mädchen allerdings getrennt mit weiblichen Lehrkräften. Damit wurde das kleine Béarn das erste Land Europas, welches kostenlosen Unterricht für Mädchen zusicherte, und zwar mit der interessanten Begründung, dass sie so im Stande waren, ihr Brot zu verdienen und sich der Gesellschaft nützlich zu machen („Pareil rolle sera aussy faict des filles qui sont en bas aage et qui n´ont nul moyen de vivre et de s´entretenir, par toutes les églises, afin que de mesmes deniers et en écolle séparée elles soient enseignées, nourries et tenues par des femmes sages et pudiques, par leur industrie pouvoir aprés se nourrir et entretenir et servir au public“. Art. 32 der Verfassung der Akademie von 1566, zitiert nach Desplat 2004). Desplat unterstreicht die säkulare Ausrichtung der Ausbildung. Allgemein wird behauptet, der Zweck des Unterrichts in protestantischen Ländern sei, die Bevölkerung des Lesens der Bibel und des Katechismus zu befähigen. Hier werden nur die Vorteile eines Schulunterrichts für die Gesellschaft betont.
Die Akademie wurde 1566 geöffnet. Die ersten protestantischen Akademiegründungen in Frankreich fanden in Nîmes (1562) und Montpellier statt. Vorrangiges Ziel war es, die Kirchen mit Pastoren zu versorgen, da die Akademie in Genf die steigende Nachfrage der Gemeinden kaum nachkommen konnte. Da Papst Pius V. die katholischen Universitäten angewiesen hatte, Protestanten die Abschlüsse zu verweigern (Maag 2002, 140), brauchten junge Hugenotten ihre eigenen Universitäten, die dann auch gegründet wurden, vor allem in Leiden und Heidelberg, aber auch in Frankreich und benachbarten Gebieten wie Béarn, Orange und Sedan, die alle zu diesem Zeitpunkt unabhängig waren.
Jeanne hatte sehr gute Gründe, langsam und überlegt vorzugehen. Der Kardinal von Armagnac ließ sie wissen, dass sie die Bevölkerung Béarns in Ruhe lassen sollte, ihre Untertanen wollten ihren Katholizismus nicht aufgeben. Jeanne antwortete, dass sie in Béarn nur Gott über sich habe, dort könne sie ihrem Gewissen folgen, und in ihrem Land werde niemand wegen seines Glaubens verfolgt. Das letzte war ihr ein Anliegen, denn 1571 schrieb sie an ihren Statthalter, den Baron d´Arros, dass in ihrem Land niemand zum Glauben je gezwungen worden war und es auch nicht werden sollte („...intention n´a point esté et n´est encores qu´ilz soyent contraints par force et violence de se reanger à ladite Religion“, d´Aas 2002, 452).
Als sie sich bei der Einführung der Reformation in ihren Ländern unnachgiebig zeigte, zitierte der Papst sie nach Rom zwecks eines Ketzerprozesses. Da sie dieser Einladung nicht folgte, exkommunizierte er sie. Der Bann war eine ernste Bedrohung, da jeder katholische Herrscher jetzt das Recht hatte, ihre Länder an sich zu reißen und sie abzusetzen, eine Chance, die Philipp II. von Spanien sich nicht entgehen lassen würde. Katharina von Medici verteidigte deshalb Jeanne, weil sie keine spanische Präsenz auf der französischen Seite der Pyrenäen dulden wollte. Außerdem war sie eine Verfechterin der gallikanischen Freiheit der französischen Kirche und meinte deshalb, der Papst solle sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einmischen.
Königin der Hugenotten
Nach dem ersten Religionskrieg (1562-63) ließ Katharina von Medici den jungen Karl IX. mündig erklären und führte ihn mit dem Hof auf eine große Frankreichreise, die mehrere Jahre dauerte. Der Zweck dieser Reise war es, den König dem Volk zu zeigen, und damit die Loyalität der Bevölkerung zu erhalten. Jeanne wurde als Vasallin einberufen und stieß Ende Mai 1564 zum Zug in Macon.
Ihr Sohn Heinrich nahm auch Teil an diese Reise und seinetwegen stritten die zwei Königinnen sich, weil Jeanne ihn bei ihren protestantischen Gottesdiensten dabei haben wollte, und Katharina wünschte, dass er mit der königlichen Familie zur Messe gehe. Schließlich sandte Karl IX. Jeanne zu ihrem Besitz in Vendôme, während Heinrich als Gouverneur von Guyenne den Zug begleitete und in den Städten für den feierlichen Empfang des Königs sorgte.
Jeanne durfte nicht mit nach Bayonne, wo Katharina ihrer Tochter Elizabeth, Königin von Spanien, begegnen wollte. Philipp II. sandte als seinen Gesandten den Herzog von Alba, der auf dem Weg in die Niederlande war. Die Hugenotten waren später überzeugt, dass Alba und die Königinmutter in Bayonne ihre Ausrottung geplant hatten. Sicher ist, dass Alba in den Niederlanden mit aller Härte gegen die Protestanten vorging, und es ist durchaus möglich, dass er versuchte, Katharina auf seinen mörderischen Kurs einzustimmen. Schon 1568 – also vor der Bartholomäusnacht! – schrieb Jeanne, dass die Waffen, die gegen die Hugenotten verwendet werden sollten, in Bayonne geschmiedet worden seien (Ample déclaration).
Jeanne und Heinrich trafen sich später in Paris. 1566 ersuchte sie erneut um Erlaubnis, mit ihren beiden Kindern nach Béarn zu fahren, was ausgeschlagen wurde. Sie erhielt aber Erlaubnis, ihren Sohn in seinen französischen Ländereien herumzuführen, und Anfang 1567 reiste sie dann mit ihm nach Vendôme, und von dort setzte sie sich unerlaubt ab nach Béarn. Damit machte sie laut des Biographen Heinrichs, Pierre Babelon, aus einem französischen Prinzen einen Ausländer, und vor allem einen Hugenotten.
Von 1567 an arbeitete Jeanne für die Zukunft ihres Sohnes. Ihre Lebensaufgabe, schrieb sie selbst, sei: Gott, Königtum und ihr Blut. Mit Gott war die reformierte Religion, die wahre Kirche Gottes, gemeint. Mit dem König ihr Status als Vasallin und – trotz Béarn – als Französin, und mit dem „Blut“, die Familie, zuallererst ihr Sohn Heinrich. Er sollte von jetzt an kein Höfling mehr sein, sondern die Aufgaben eines Regenten lernen. Als ein Aufstand in Navarra niedergeschlagen worden war, wurde er dorthin geschickt, um die Basken zu befrieden. Als 14jähriger hielt er für seine Untertanen eine Rede, in welcher er ihr Fehlverhalten geißelte, ihnen die Gunst der Königin zusicherte, falls sie sich verbessern würden, und seinen berühmten Charme mit seinem Autoritätsanspruch verband.
Im Herbst 1567 versuchten die Hugenotten, die sich von der Aufrüstung des Königs bedroht fühlten, Karl IX. in ihre Gewalt zu bringen. Die Entführung missglückte, und die königliche Familie suchte, beschützt von den schweizerischen Söldnern, die die Ängste der Hugenotten verursacht hatten, Zuflucht in Paris. Die Hugenotten belagerten die Stadt. Im November wurden sie vor den Toren von St. Denis geschlagen und mussten sich in die Provinz zurückziehen, wo sie den Kampf bis zum Friedenschluss von Longjumeau im März 1568 fortsetzen.
Der Friedensvertrag war an sich nicht ungünstig für die Hugenotten, nur haperte es wie immer mit der Umsetzung. Katholische Behörden waren über die für die Hugenotten günstigen Bedingungen empört und setzten sie nicht um. Der Protestant La Noue schrieb in seinen Erinnerungen, dass der Krieg zwar viel Unheil bringe, aber dieser elende kleine Friedensvertrag sei viel schlimmer für die Reformierten, die in ihren Häuser umgebracht wurden, ohne dass sie sich zu wehren wagten („ …une guerre est misérable et qu´elle apporte avec soy beaucoup des maux…cette méchante petite paix est beaucoup pire pour ceux de la Réligion, qu´on assassinoit en leur maisons, et ne s´osoyent encores défendre“, d´Aas 2002, 382) Im Laufe des Sommers 1568 versuchten die Gruppierungen noch einmal miteinander zu reden, Karl IX. sandte einen Botschafter nach Béarn, und Jeanne verfasste ein Sendschreiben an den König mit dem Antrag, den Frieden in Guyenne wiederherzustellen.
In der Zwischenzeit fühlten sich der Prinz von Condé und der Admiral Coligny auf ihre Schlösser in Bourgogne zunehmend bedroht. Der Herzog von Alba wollte in den Niederlanden mit Feuer und Schwert den Protestantismus auszurotten, und Flüchtlinge berichteten ihnen von seinem Terror. Am 23. August 1568 flüchteten sie mit ihren Familien und Angehörigen über die Loire nach La Rochelle. Die Überquerung der Loire erinnerte fast an den biblischen Durchzug durchs Schilfmeer: so viele Hugenotten hatten sich angeschlossen, dass der Zug fast wie eine Völkerwanderung aussah, und die Loire hatte in der Augusthitze einen so niedrigen Wasserstand, dass Sandbanken in der Mitte auftauchten. Dementsprechend sangen alle Psalm 114 vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, als sie hinüber waren. Die Parallele wurde noch einmal deutlich, als die königlichen Truppen, die sie verfolgten, wegen plötzlich einsetzenden Hochwassers den Fluss nicht überqueren konnten.
In dieser Situation war Jeanne zutiefst gespalten. Bislang hatte sie die Kriege moralisch unterstützt, aber nicht selbst teilgenommen. Falls es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte, konnte sie immer mit ihren Kindern in der uneinnehmbaren Festung Navarrenx Zuflucht suchen. Sie hatte jedoch ihren Sohn, der als zukünftiger Führer der Hugenotten das Kriegshandwerk lernen sollte, und so musste sie wählen, ob sie in Béarn unter ihrem Volk bleiben oder sich den Hugenotten anschließen sollte: „ich hatte den Krieg im Bauch“ schrieb sie danach („J´eu la guerre en mes entrailles“, Ample declaration). Sie setzte den Baron d´Arros als Statthalter ein, und Anfang September begab sie sich in Eilmarsch nach La Rochelle (Cocula 2004). Dort konnte sie ihren Sohn dem Prinzen von Condé überantworten. Sie schrieb unterwegs eine Reihe Briefe an Karl IX., an Katharina von Medici, an ihren Schwager, den Kardinal von Bourbon und an die Königin Elizabeth von England, um ihren Entschluss zu begründen. Angekommen in La Rochelle schrieb sie eine Erklärung („Ample declaration“) um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie sich der hugenottischen Armee zugesellte.
Die Hugenotten unter ihren Anführer aus der königlichen Familie wollten nicht als Aufrührer dastehen. Sie behaupteten, die erzkatholische Partei sei schuld daran, dass königliche Befehle nicht vollzogen wurden. Die Katholiken mit ihren Verbindungen nach Spanien und Rom seien Landesverräter. Die Politik des Kardinals von Lorraine verdient laut Sutherland (1974) keinen anderer Namen. Wenn Jeanne vom Frieden sprach, meinte sie eine Duldung der Hugenotten in Frankreich. Die Forderungen der Hugenotten waren immer dieselbe: Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, Gerichte mit zur Hälfte hugenottischen Richtern, sichere Zufluchtsstädte – deren Anzahl schwankte in den Verhandlungen – und Zugang zu Ausbildung und Beamtenstellen gleichrangig mit den Katholiken. Die Provinz Languedoc unter dem moderat katholischen Gouverneur Montmorency-Damville war ein friedlicher Ort in den Religionskriegen, weil Damville den Hugenotten solche Rechte einräumte, und die katholische Bevölkerung sich damit abfand.
Im März 1569 fand eine Schlacht bei Jarnac statt. Der Prinz von Condé kämpfte mit, wurde verwundet und nach der Schlacht ermordet. Es gelang Admiral Coligny, die hugenottischen Truppen zusammenzuhalten, aber der Verlust des Prinzen war ein herber Schlag. Heinrich von Navarra war jetzt der ranghöchste Prinz, und zusammen mit seinem Vetter, dem gleichaltrigen Heinrich von Condé, wurde er jetzt Oberbefehlshaber über die Armee der Prinzen. In Wirklichkeit lag die Verantwortung für die Kriegsführung bei dem erfahrenen Admiral, und die beiden Prinzen wurden seine Pagen genannt.
Jeanne blieb in La Rochelle, während Coligny mit den Prinzen im Krieg war, und sie konnte, unterstützt von einem Rat adliger Hugenotten, die „Regierungsgeschäfte“ regeln. Sie schrieb an England und nach Deutschland. Sie unterzeichnete Erlässe, versuchte Geld für das Heer aufzutreiben, pfändete ihren schönsten Schmuck für einen Kriegsdarlehen an Elizabeth von England und ließ ein Kriegsschiff namens „Die Hugenottin“ bauen.
So wie sie immer behauptete, nicht gegen den König, sondern gegen seine schlechten Ratgeber zu kämpfen, so behauptete Karl IX., dass sie in La Rochelle von den Hugenotten gefangen gehalten wurde, und er ließ den Baron Terride mit einer „Befreiungsarmee“ in Béarn einfallen. In kürzester Zeit waren ganz Béarn und Navarra erobert und zum Katholizismus zurückgeführt. Nur der Baron d`Arros hielt im Navarrenx stand. Um ihre Länder zurückzuerobern, sandte Jeanne den Graf von Montgommery mit einer „Hilfsarmee“ nach Navarrenx. In noch kürzerer Zeit als Terride gebraucht hatte, verjagte er ihn aus Béarn. Die Befreiung von Terride wurde in Pau mit einem Festgottesdienst gefeiert, wobei Pierre Viret über Psalm 124, 7: „Unsere Seele ist aus dem Netz des Vogelfängers entkommen“ predigte.
Vom Winter 1569 bis zum Frühjahr 1570 führte Coligny sein Heer mit den Prinzen Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé durch ganz Südfrankreich und von Provence nach Norden, bis er Paris bedrohte. Der König hatte kein Geld mehr, um Krieg zu führen, und musste notgedrungen Friedensverhandlungen einleiten. Im August 1570 wurde dann der Frieden von St. Germain geschlossen. Wiederum war Jeanne d´Albret diejenige, die auf Augenhöhe mit dem König verhandeln konnte. Der Vertragstext erklärt immer wieder, dass der König die Bedingungen seiner Tante erfüllen wollte (Sutherland 1980, Potter 1997).
Jeanne blieb vorläufig in La Rochelle. Im April 1571 fand dort die Nationalsynode der reformierten Kirchen Frankreichs statt. Theodor Beza kam aus Genf angereist, um die Synode zu leiten. Pierre Viret wollte teilnehmen, starb aber vorher, vermutlich hatte seine Gesundheit in der Gefangenschaft unter Baron Terride gelitten. Auf der Synode wurde das französische Glaubensbekenntnis von 1559 neu verhandelt und die endgültige Fassung als „Bekenntnis von La Rochelle“ beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Kirchenordnung für Béarn beschlossen, und die Synode diskutierte Fragen, die Jeanne d´Albret gestellt hatte. Als Ersatz für Pierre Viret bekam sie Nicolas des Gallars zur Seite gestellt. Er war Calvins Sekretär gewesen, danach hatte er die „Strangers´ Church“, die Kirche für Ausländer in London, als Nachfolger für Johannes à Lasco geleitet und dann an Bezas Seite im Colloquium von Poissy 1561 gestanden. Er war Pastor in Orléans gewesen und wurde jetzt Seelsorger für Jeanne d´Albret und ihr theologischer Ratgeber für die Kirche in ihrem Land.
Er war eine gute Wahl, denn während Beza sehr an dem Konzept von Genf hing und ein presbyteriales Kirchenverständnis (Kingdon 1967) hatte, war des Gallars in England gewesen, als Königin Elizabeth nach dem Tod ihrer katholischen Schwester die anglikanische Kirche einführte. Außerdem behauptet Bernard Roussel (2004), dass er das Buch Martin Bucers „De regno Christi“ von 1550 mitbrachte. Dieses Buch ist dem englischen König Edward VI. gewidmet und beschreibt, wie ein König eine reformierte Kirche leiten kann. Damit hatte des Gallars ein Konzept für eine von einer Fürstin geleitete Kirche, die dann in den Jahren als Heinrich und Katharina von Navarra das Erbe der Mutter verwalteten, Bestand hatte.
Während Jeanne in La Rochelle noch weilte, ereilte sie ein Angebot von Katharina von Medici, ob ihren Sohn Heinrich die Tochter Katharinas heiraten mochte. Hugenotten und Katholiken würden sich versöhnen und die Häuser Valois und Bourbon sich nahekommen. Dieses Angebot war zu verlockend, um es auszuschlagen, aber Jeanne traute Katharina nicht so recht, jedenfalls wollte sie nicht gleich nach Paris ziehen, um über die Ehe zu verhandeln.
Stattdessen fuhr sie nach Pau zurück, führte die neu beschlossene Kirchenordnung ein und kümmerte sich um ihre Länder. Die Tuberkulose machte sich bemerkbar und sie wollte zur Kur in die Bergen fahren. Währenddessen zogen sich die Eheverhandlungen hin, bis Jeanne endlich im Frühjahr 1572 nach Paris zog. In den Briefen an ihren Sohn hört man von den Verhandlungen, von ihrer Missbilligung des höfischen Lebens und von ihrem Ärger mit Katharina. Jeanne wollte so viele Rechte wie möglich für ihren Sohn und die Hugenotten aushandeln. Am Ende musste sie es aufgeben, Margareta von Valois, Margot genannt, zum reformierten Glauben zu bekehren. Dafür hoffte sie aber, dass das Brautpaar nach Béarn ziehen würde. Eine königliche Mischehe war etwas ganz Neues und musste in Detail besprochen und geplant werden. Jeanne handelte das Meistmögliche für ihren Sohn aus und im April 1572 wurde eine Einigung erzielt. Heinrich sollte allerdings noch eine Weile in Béarn bleiben und Jeanne bereitete in Paris die Hochzeit vor.
Die zähen Verhandlungen im Frühjahr hatten viel Kraft gekostet, Jeanne hielt sich aber tapfer. Im Juni brach sie zusammen und starb am 9. Juni an der Tuberkulose, die sie seit Jahren geplagt hatte. Später entstanden Gerüchte, sie sei von Katharina von Medici vergiftet worden. Diese sollte ihr ein Paar Handschuhe, die von ihrem privaten Giftmischer präpariert worden seien, geschenkt haben. Da Katharina nach den Massakern von St. Bartholomäus, die in der Periode von August bis November 1572 stattfanden, von den Hugenotten als der Inbegriff des Bösen dargestellt wurde, gehört der Giftmord an Jeanne d´Albret zu den Verleumdungen.
Heinrich traf erst etwas später in Paris ein. Im Testament Jeannes hatte sie sich gewünscht, in Béarn bei ihrem Vater beerdigt zu werden. Ihr Sohn setzte sich über ihren letzten Willen hinweg: sie wurde nach Vendôme geführt und neben ihrem Mann, Anton von Bourbon, bestattet.
Trotz ihre Fähigkeiten wurde sie eine Fußnote in der Geschichte Frankreichs: ihr Sohn wurde zwar als Heinrich IV. König von Frankreich, aber er wurde katholisch und aus den Hugenotten wurde, dank des Ediktes von Nantes 1598, eine geduldete Minderheit. Die Kirche, die Jeanne in Béarn aufgebaut hatte, wurde unter ihrem Enkelsohn, Ludwig XIII., verboten. 1685 wurde dann das Edikt von Nantes aufgehoben, und die Reformierten wurden grausam verfolgt. Viele flüchteten, viele konvertierten und viele wurden umgebracht. Die großen Hoffnungen, die die Hugenotten um Jahr 1560, als Jeanne konvertierte, hegten, erwiesen sich als trügerisch.
Wenn auch letztlich nicht erfolgreich, war sie dennoch bewundernswert. Mit dem Admiral Coligny zusammen hatte sie den Frieden von St. Germain errungen, dann eine Landeskirche aufgebaut und ihre Kinder gefördert. Sie war die reformierte Präsenz in der königlichen Familie und in ihren letzten Jahren wurde sie die Königin der Hugenotten.
Stammtafeln der Familie von Valois und der Familie von Bourbon (PDF)
Literatur
Quellen:
Albret, Jeanne d´: Lettres suivies d´une ample Déclaration, ed. Bernard Berdou d´Aas, Biarritz 2007.
Bordenave, Nicolas de: Histoire du Béarn et de la Navarre, Paris 1873.
Bucer, Martin: De regno Christi: libri duo, 1550, ed. François Wendel, in: Robert Stupperich, Hrsg. Ser. 2, Opera latina Bd. 15,1, Gütersloh 1955. In: Studies in Medieval and Reformation Thought, Leiden 1982. „Du royaume de Jesus Christ“, édition critique de la traduction française de 1558/texte établi par François Wendel, Bd.15,2, Gütersloh 1954.
Calvin, Johannes: Calvini opera quae supersunt omnia (= CO), hrsg.v.W.Baum, E.Kunitz, E.Reuss, 59 Bde, Braunschweig/Berlin 1863-1900.
Calvin-Studienausgabe (= CStA), hrsg.v. E.Busch u.a., Neukirchen-Vluyn ab 1994.
Coudy, Julien, ed.: Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten, Darmstadt 1965
Potter, David, ed.: The French Wars of religion, Selected Documents, London & New York 1997.
Ruble, Alphonse de: Le mariage de Jeanne d´Albret, Paris 1877.
Ruble, Alphonse de: Antoine de Bourbon et Jeanne d´Albret, Paris 1881, 1882, 1885 & 1886, 4 Bde.
Ruble, Alphonse de: Jeanne d´Albret et la guerre civile, Paris 1897.
Ruble, Alphonse de: Mémoires et poésies de Jeanne d´Albret, Paris 1893, Slatkine Reprints Genf 1970 (online auf Französisch: https://archive.org/details/mmoiresetposies00rublgoog).
Stegman, A.: Les édits des guerres de religion, Paris 1979.
Sekundärliteratur:
Aas, Bernard Berdou d´: Jeanne III d´Albret, Chronique 1528-1572, Anglet 2002.
Actes du colloque “Arnaud de Salette et son temps – Le Béarn sous Jeanne d´Albret”, Orthez 1984 (war mir leider nicht zugänglich).
Actes du colloque “L ´Amiral de Coligny et son Temps”, Paris 1974.
Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Babelon, Pierre: Henri IV, Paris 1982.
Benedict, Philip, ed.: Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam 1999.
Benedict, Philip: “Confessionalization in France? Critical reflections and new evidence”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Bryson, David: Queen Jeanne and the Promised Land, Dynasty, Homeland, Religion and Violence in Sixteenth Century France, Leiden 1999.
Buisseret, David: Henry IV, London 1984.
Cazaux, Yves: Jeanne d´Albret, Paris 1973.
Cholakian, Patricia F. & Cholakian, Rouben C.: Marguerite of Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006.
Cocula, Anne-Marie: ”Été 1568. Jeanne d´Albret et ses deux enfants sur le chemin de La Rochelle”, Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Desplat, Christian: “Jeanne d´Albret, un modèle d´éducation maternelle?”, in: Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Eurich, Amanda: “Le pays de Canaan”: L´évolution du pastorat béarnais sous Jeanne d´Albret”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Graeslé, Isabelle: Vie et légendes de Marie Dentière, Bulletin du centre protestant d´études, Genéve 2003.
Greengrass, Mark: “The Calvinist experiment in Béarn”, in: A. Pettegree, A. Duke & G. Lewis: Calvinism in Europe 1540 - 1620, Cambridge 1994.
Kingdon, Robert M.: Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572, Genève 1967.
Knecht, R.J.: Catherine de´ Medicis, London 1998.
Kuperty-Tsur, Nadine: “Jeanne d´Albret ou la persuasion par la passion”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Lambin, Rosine: Calvin und die adelige Frauen im französischen Protestantismus, http://www.reformiert-info.de/2304-0-0-20.html
Maag, Karin: “The Huguenot academies: preparing for an uncertain future”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Martin-Ulrich, Claudie: “Récit de vie, récit de mort: Le Brief discours sur la mort de la royne de Navarre, Jeanne d´Albret” in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Mentzer, Raymond A. & Spicer, Andrew, eds.: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Nielsen, Merete: Theologie als Erzählung – erzählte Theologie, Das Heptameron von Margarete von Navarra, http://www.reformiert-info.de/side.php?news_id=5444&part_id=0&navi=4
Nielsen, Merete: Marie Dentière,
Trinitätslehre und interreligiöser Dialog
Von Eberhard Busch

Das Problem
Die christologische Wurzel der Trinitätslehre
Die Frage nach dem Sinn der Einheit Gottes
Die Frage nach dem Sinn der Menschwerdung Gottes
Das Problem
Das Thema stellt uns vor ein doppeltes Problem. Auf der einen Seite ist gerade die Trinitätslehre ein Stein des Anstoßes im Verhältnis zum nicht-christlichen Judentum und zum Islam. Die Kirche scheint mit dieser Lehre eine Annäherung der drei sogenannten monotheistischen Religionen zu stören.
1994 erklärte Oberrabbiner A. Steinsaltz in Jerusalem, für das Judentum sei eine Verständigung mit dem Islam, aber niemals mit der Kirche möglich1. Denn so lautet der Einwand von den beiden anderen Seiten, daß die Kirche mit dem Glauben an den Dreieinigen den reinen monotheistischen Glauben verletzte: den Glauben an den, der »Einer von einer Einheit (ist), die in keiner Hinsicht ihresgleichen hat.«2 Ja, Jules Isaac sah eine Hauptwurzel des Antisemitismus in der christlichen Ablehnung »der strengsten Auffassung des Monotheismus« im Judentum3. Der Einwand erstaunt. Haben nicht gerade die Reformierten stets auf das gepocht, was zu Anfang im Hugenottenbekenntnis steht: »Wir glauben und bekennen, daß es nur einen, einzigen Gott gibt«?4 Hat nicht Calvin ein Abweichen vom Sch'ma Israel – »unser Gott ist ein einziger Gott« (Dtr. 6,4) – sogar »ein Verbrechen« genannt?5
Doch fährt Calvin so fort, daß dieses Sch'ma »auch einen brauchbaren Beweis für die Gottheit Christi und des heiligen Geistes« biete. »Denn wenn Christus mehrfach in der Schrift als Gott angeredet wird (z.B. Joh. 20,28; Röm. 9,5)«, so muß er »derselbe« sein, »der sich selbst als den einzigen Gott erklärt.« Aber eben dagegen richtet sich der antitrinitarische Einwand: entscheidend gegen das Bekenntnis der Gottessohnschaft Jesu, verstanden als seine Gottheit. Der Koran läßt zwar Jesus als einen Propheten gelten, nennt aber die Christen Götzendiener, weil sie sagen: »Allah sei Christus, der Sohn der Maria.«6 Denn damit würden sie, statt den einen Gott, auch noch einen Menschen anbeten und somit eine Kreatur vergöttern.
Und um eine andere, aber in ähnliche Richtung weisende Stimme danebenzustellen, die von M. Buber: Es sei im Widerspruch zum christlichen Bekenntnis Juden »unmöglich, irgend etwas Einmaliges als die endgültige Offenbarung Gottes zu nehmen ... Wir sprechen ... keiner seiner Offenbarungen die Unüberbietbarkeit zu, keiner den Charakter der Inkarnation ... Gott ist jeder seiner Manifestationen schlechthin überlegen.«7 Wenn aber dergestalt der Glaube an die Einheit Gottes mit dem Inkarnierten »unmöglich« ist, dann fällt damit die wesentliche Voraussetzung für die Trinitätslehre hin. Oder umgekehrt: Es bereitet diese Lehre mit dieser ihrer Voraussetzung für die Sicht eines gegenüber allen seinen Manifestationen überlegenen und darum einen Gottes einen unerträglichen Anstoß.
Für Christen stellt sich mithin die Frage, ob etwa dieser Stein des Anstoßes zu mildern ist, so daß er einiges von seiner Anstößigkeit verliert, so daß der kirchliche Glaube kompatibler wird mit jenem »reinen« Monotheismus? Immerhin wäre das ein Eingriff tiefen Ausmaßes. Denn es geht hier um kirchliches Bekenntnis und um keine beliebige Manipulationsmasse. Unter Anrufung des Namens des dreieinigen Gottes wird der christliche Gottesdienst durchgeführt, und mit der Taufe »auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes« (Mt. 28,19) beginnt das christliche Leben. Und der für die reformierte Kirche verbindliche Heidelberger Katechismus sagt in Fr. 25: »Wenn nur ein einziges göttliches Wesen ist, warum nennst du drei: den Vater, Sohn und Heiligen Geist? Weil sich Gott also in seinem Wort geoffenbart hat, daß diese drei unterschiedlichen Personen der einige, wahrhaftige, ewige Gott sind« – diese drei, denen nach Fr. 24 die drei großen Gotteswerke zugeordnet sind: dem Vater unsere Erschaffung, dem Sohn unsere Erlösung, dem Geist unsere Heiligung. Haben wir also nicht auf diese Lehre zu insistieren, auch wenn sie jener Stein des Anstoßes sein sollte?
Aber nun die andere Seite des Problems: Können wir darauf insistieren, wenn es etwa so ist, daß man in der christlichen Kirche uneins darüber ist, was eigentlich diese Lehre besagt? ja, wenn sie zwar noch in rituellen Formeln zitiert wird, aber so, daß Viele das eher als ornamentalen Schnörkel empfinden denn als Ausdruck lebendiger Glaubenserkenntnis? ja, wenn auch von fachtheologischer Seite die Brauchbarkeit und Notwendigkeit der Lehre infrage gestellt worden ist? Wer vermag auch nur an Trinitatis tröstlich und erbaulich darüber zu predigen?
Zwar haben die alten Vertreter der Lehre stets darauf Wert gelegt, daß sie Anhalt an der Bibel hat; der Heidelberger beruft sich hier auch auf alttestamentliche Stellen. Aber die Lehre als solche ist erst im 4. Jhdt. von der Kirche formuliert worden, unter viel Widersprüchen und Streitigkeiten, die gegenüber der Lehre durch all die Jahrhunderte nie verstummt sind. Die Reformation8 ist ihr zunächst mit Skepsis begegnet. Auch wenn sie sie dann entschieden bejaht hat, so ist auf ihrem Boden die Bewegung entstanden, die sich die Ablehnung dieser Lehre auf die Fahnen schrieb und zur Bildung der unitarischen Kirche führte.
Mehr noch: Das Anliegen dieser Antitrinitarier ist seit der Aufklärung auch in die Kirchen der Reformation eingeströmt und hat das Denken in ihr seither aufs nachhaltigste bestimmt. Es sei erinnert an den frühen Theologen jener Bewegung, Fausto Sozzini, bei dem schon alle modernen Argumente gegen die Trinitätslehre beisammen sind. Bei ihm ist interessant zu sehen, was der innere Antrieb zu seiner Kritik ist, – sie steht im Rahmen eines gegen die Reformation gerichteten theologischen Gesamtkonzepts9.
Sein Anstoß bezog sich nämlich zuerst auf die Lehre von der Gnade und Versöhnung: Wie sollten wir einer solchen bedürfen – wenn einerseits unsere Sünde so wirklich groß nicht ist, wenn es andererseits unmoralisch ist, daß wir durch das gute Tun eines Anderen selbst gut (d.h. gerechtfertigt) sein sollten? Der Mensch, auch der Sünder, kann und soll sich selbst bessern. Sicher, wir bedürfen dabei auch eines göttlichen Verzeihens. Aber »Gott verzeiht uns auch schon ohne blutigen Opfertod Christi, aus Liebe«, die Gott immer hat und der gegenüber die Idee von einer Genugtuung verlangenden Gerechtigkeit Gottes unterchristlich wäre.
Christus als ein zu unserer Erlösung nötiger Gottmensch ist daher überflüssig, ja, gefährlich. Und darum ist er denn auch kein Gott. Er ist nichts als Mensch, wenn auch ein besonderer, einer »mit Weisheit ohne Maß«, weil er uns, viel reiner als Mose, das Gesetz Gottes gelehrt und vorgelebt hat. Mithin gilt auch der Heilige Geist nicht als Gott, nur als eine beflügelnde Kraft in den Geschöpfen. Also, das die Folge, nicht der Ausgangspunkt des Gedankengangs, wenn auch nun als ein zur Seligkeit nötiger Satz: Gott ist ein Einziger, kein Dreieiniger.
Wir finden all das dann zu Beginn des Jahrhunderts wieder bei A. von Harnack, vermehrt durch die These, das altkirchliche Dogma bedeute eine verfremdende »Hellenisierung« des Christentums10. Die habe es formal zu einem unethischen Intellektualismus verformt (142f.), material dazu, den Jesus, der nicht in das – von ihm ja nur verkündete – Evangelium gehört (91), doch als einen erlösenden Gottmenschen in dessen Mitte zu stellen. Mit schlimmen Folgen: Denn auf dem Boden dieses Dogmas »haben die Menschen ihre religiöse Lehre zu furchtbarer Waffe geschmiedet und Furcht und Schrecken verbreitet« (79).
Es war daher ein schwerer Fehler der Reformation, daß sie »die alten Dogmen von der Trinität und den zwei Naturen in das Evangelium hinein« nahm (183). Harnack sah allerdings nicht eine davon gesäuberte Kirche in größerer Nähe zu Judentum und Islam. Im Gegenteil! Seine Forderung zum Verzicht auf das Dogma geht bei ihm wie schon bei Sozzini bruchlos Hand in Hand mit der Forderung, endlich das doch rein jüdische Alte Testament aus der christlichen Bibel auszuscheiden.
Warum? Weil durch das Alte das Neue des Neuen Testaments verhüllt werde: das Evangelium von dem Gott der reinen, von allem gesetzlichen Zorn gereinigten Liebe! Weil das Judenchristentum dieses Neue verkannt hat, weil es sich als »die Vollendung der alten Religion durch Erfüllung « verstehen wollte und dadurch mit ihr verzahnt blieb, darum ist es zurecht »überwunden worden«. Zwar hat sich die Kirche von ihm befreit. Aus ihm ging dann aber der Islam hervor11. Wiederum, weil die Kirche mit jenem Dogma der Erkenntnis der reinen Liebe Gottes im Wege stand, also das Neue des Evangeliums nicht erfassen konnte, darum konnte es weder das Alte Testament noch den Islam überwinden12.
Da heute bei der Bemühung um einen Dialog mit Judentum und Islam auch wieder Argumente wie die genannten gegen die Trinitätslehre auftauchen, könnte uns Harnacks These daran erinnern, daß ein Abschleifen dieses Steins des Anstoßes noch keine Annäherung an die anderen Seiten bedeuten muß. Vor allem aber zeigt das Angedeutete, daß diese Lehre nicht so etwas wie ein Schatz in der Hand der Kirche ist, den sie nur noch anderen zu erklären hätte.
Sie hat sich zuvor selbst noch einmal ganz neu darüber klar zu werden, was denn der gute Sinn dieser Lehre ist. Es versteht sich, daß ich hier nur versuchen kann, ihren Sinn zu bezeichnen, und daß dann eben ich diesen Versuch zu verantworten habe, ohne behaupten zu können, daß die Kirche, geschweige die Theologie so lehrt, doch in der Meinung, daß die Kirche sie so verstehen sollte und daß ich längst nicht der Einzige bin, der sie so versteht.
Die christologische Wurzel der Trinitätslehre
Den Satz Harnacks halte ich freilich für richtig: »Das Bekenntnis zu dem Vater, dem Sohn und dem Geist ist ... die Entfaltung des Glaubens, daß Jesus der Christ sei.«13 Dessen war man sich auch in der alten Kirche bewußt, wie schon Irenäus formulierte: »Der Name Christus bedeutet den, der salbt und der gesalbt worden ist und die Salbung selbst, mit der gesalbt wurde. Es salbte aber der Vater, gesalbt wurde der Sohn, im Geist, der die Salbung ist.«14
Die christologische Wurzel der Trinitätslehre ist es ja auch vor allem, auf die sich die antitrinitarische Kritik in und außer der Kirche bezieht. Es war sowohl historisch wie sachlich so, daß man sich in der Alten Kirche nicht vor der Frage sah: Wie können wir drei – »Subjekte« (sagt man heute geradezu) zusammendenken und zugleich so demokratisch auffassen, daß keiner der drei zukurzkommt? Das wäre schon im Ausgangspunkt eine verkehrte Fragestellung, weil dann unverständlich wäre, warum gerade drei und nicht mehr oder weniger »Subjekte«. Die Frage an der Wurzel der Lehre war die: Wer ist Jesus Christus? Und ihre klare Antwort auf diese Frage lautete: Er ist als der, der ganz auf der Seite Gottes steht, der an unsere Seite Gekommene. Erst diese Antwort hat dann die Frage nach dem Heiligen Geist und so die nach der Dreieinigkeit Gottes aufgeworfen.
Ich denke, daß das den Weg beschreibt, auf dem es zu einem angemessenen und auch tröstlichen Verständnis der Trinitätslehre kommt. Dieser Weg nimmt seinen Ausgang an der Frage: Wer ist Jesus Christus? Je nach dem, wie diese Frage beantwortet wird, wird man sich zur Trinitätslehre stellen: sie bejahen, sie abschwächen, sie umdeuten oder sie verwerfen. Und wer sie ganz verwirft, für den wird Jesus Christus nichts sein als jener musterhafte Bruder, den Buber in ihm sah, oder als ein jüdischer oder auch, nach dem Koran, judenkritischer Prophet.
Die Antwort auf jene Frage aber, zu der sich die Kirche in langen Mühen durchrang, ist die im neutestamentlichen Zeugnis im Kern schon vorgegebene. Sie legten das da Vorgegebene dabei gewiß in ihrer griechischen Sprach- und Denkweise aus. Aber wer ihr Bekenntnis bislang davon befreien wollte, hat in der Regel mit ihrer Sprache auch die damit bezeichnete Sache verworfen. Die These, daß die alte Kirche mit ihrer Sprache dem griechischen Geist zuliebe das Evangelium als solches verkehrte, pflegt zu übersehen, daß ihre Antwort auf jene Frage »den Griechen eine Torheit« sondergleichen war.
Wie neuplatonisches Denken die da nötige Antwort hindert, kann man an der Trinitätslehre von Origenes sehen, die zum Glück nicht orthodox wurde. Und was religiös gehauchter griechischer Geist ist, kann man bei den jüdischen Theologen Philo oder Maimonides studieren, nach denen Gott als der eine Geist derart jenseits aller irdisch-körperlichen Welt ist, daß er »nicht als Träger einer Gestalt erfahren« werden kann15. Aber genau dieses den Griechen Querlaufende sagte die Kirche in ihrer Antwort auf die Frage, wer Jesus Christus ist.
Wer ist er? »Bist du, der da kommen soll?«, so hörte sie das Neue Testament fragen, und sie hörte es auf diese Frage die klare Antwort geben: Ja, er ist der! »Sie werden ihn Immanel heißen, den ›Gott mit uns‹« (Mt. 1, 23). Der Eine, nicht einer unter anderen. Nicht nur einer wie wir, auch kein bloß besserer als wir. Sondern der im Anfang bei Gott, Gott selbst war und nun »in sein Eigentum kommt« (Joh. 1,11), der »Fleisch wurde und unter uns wohnte, und wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit« (V. 14).
Er ist der, der, obwohl in Gottes Gestalt, Knechtsgestalt annahm und wurde wie wir (Phil. 2,6f.), der, in dem »die Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig« (Kol. 2,9). Denn »als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau« (Gal. 4,4), um uns aus der Knechtschaft zur Gotteskindschaft zu befreien. Und »so sehr hat Gott diese Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab«, damit wir an ihn glauben und so am ewigen Leben teil bekämen (Joh. 3,16). Nicht wird hier eine Kreatur vergöttert, nicht setzen hier Menschen einen, weil sie ihn so mögen, absolut.
Im Gegenzug zu allen derartigen Verfahren wird in diesem Einen Gott Mensch, und zwar nicht besserer, sondern leidender, gekreuzigter Mensch, um sich so mit ihnen zu verbinden und ihnen so neues Leben zu schenken. Dieses Unerhörte will gehört – und dann auch verstanden sein. Das hörte die alte Kirche aus dem Neuen Testament und das verstand sie so, sagen wir, auf der Linie des Grundsatzes, den Athanasius verfocht und nach dem der Name Jesus Christus einzigartig ist, weil in ihm diese Geschichte inbegriffen ist: »Darum wurde Gott Mensch, damit wir Menschen die Seinen würden.«16
Für Athanasius ist aber nun genau diese Erkenntnis der Schlüssel der von ihm verfochtenen Trinitätslehre – nicht einfach diese oder jene Bibelstelle, aber die neutestamentliche Antwort, daß Jesus Christus der Eine ist. Wenn nämlich in Jesus Christus, in seinem Wort oder Sohn Gott in sein Eigentum kommt und »Fleisch« wird, dann ist in ihm Gott selbst unter uns, nicht nur etwas von Gott. In der Sprache von Joh. 3,16: Wenn Gott zum völligen Beweis, daß er nicht nur einige, daß er die Welt liebt, seinen Sohn in sie gibt, dann ist zwar Geber und Gabe zu unterscheiden, aber nicht zu scheiden, so als wäre die Gabe weniger als Gott selbst. Gott gibt sich selbst.
Die Gabe, die Hin-Gabe ist noch einmal Gott selbst. Wäre die Gabe weniger als ihr Geber, dann würde Gott uns nur »etwas« geben, aber sich uns vorenthalten. Dann würde Gott die Welt nicht ganz lieben, sondern sich vorbehalten, ihr auch anderes oder auch nichts zu geben. Und dann würde in dieser Gabe nicht Gott selbst uns lieben, würde uns uns selbst überlassen mit etwas, was weniger als Gott, was nicht Gott ist, statt uns in der Gabe mit dem Geber selbst zu verbinden und uns also zu den Seinen, zu seinen Kindern zu machen.
Und dann wäre es nicht Gottes Sache, uns durch seine Gabe zu den Seinen zu machen; dann wäre es unsere Sache, uns durch unser Vermögen dazu zu erheben und zu machen. Dasselbe in der altkirchlichen Sprache: Der Vater und der Sohn, diese Zwei sind zugleich »eins« (Joh. 10,30). Also ist der Sohn nicht weniger als Gott, er ist »wesenseins mit dem Vater«. Nur so ist es wirklich der wahre Gott, der in der Gabe seines Sohns in die Welt kommt und sich ihrer erbarmt. So ist der Mensch Jesus an unserer Seite nicht die Spitze des menschlichen Versuchs, »in den Himmel zu kommen«. Er ist die Spitze der Bewegung Gottes, in der er sich aus Liebe an der Seite der Menschen ihrer annimmt.
Sind aber der göttliche Geber und seine Gabe, sind der, der uns liebt, und der, in dem er uns liebt, zwar zwei und doch eines, dann folgt daraus ein Weiteres, und, dieses Weitere wird erst jetzt verständlich: Dann ist auch in dem, was der Geber in seiner Gabe bei uns bewirkt, Gott selbst am Werk. Dann ist es noch einmal nicht weniger als Gott, der das vollbringt: daß wir die Seinen werden, seine Kinder, die von ihm Geliebten, die mit ihm Verbundenen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Durch ihn kommt die Liebe Gottes in unsere Herzen (Röm. 5,5). Durch ihn werden wir Gottes Kinder (Röm. 8,14–16). Durch ihn werden sonst an den Tod Verlorene lebendig gemacht (Joh. 6,63). Einen von Gottes »Gnadengabe« gelösten Geist hat noch keine Pneumatologie als Gott verständlich machen können.
Aber indem der Heilige Geist die Gnadengabe Gottes in uns hineingibt, ist er noch einmal Gott selbst, Gott in eigener Weise, zu unterscheiden von dem Vater und dem Sohn, doch zugleich eins mit dem Vater und dem Sohn. Das sagt im Kern die Trinitätslehre: Gott ist dreimal derselbe, der eine Gott und doch kein abstrakt Einzelner, kein Einsamer. »Gott ist Liebe« (1. Joh. 4,16). Der Eine ist Beziehung. Er ist Liebe. Er wird sie nicht erst dadurch, daß er außer sich ein Anderes haben muß, um Liebe zu sein. Aber weil er wesentlich Liebe ist, darum kann er sie auch in seinem Verhältnis nach außen beweisen und beweist sie, indem er zugleich der ist, der uns liebt, der, in dem er uns liebt, und der, der uns zu seinen Geliebten macht.
Und er ist dieser eine liebende Gott in allen seinen Werken, anders in der Schöpfung, anders in der Versöhnung, anders in der Heiligung. Er ist es, mit dem Apostolikum zu reden: in der Schöpfung besonders als der Vater, in der Versöhnung besonders als der Sohn, in der Heiligung besonders als der Geist. Das letztere ist naheliegend. Aber wieso gilt die Schöpfung als Werk besonders des Vaters? Nun, die Schöpfungslehre redet von der äußeren Voraussetzung für den Beweis der Liebe Gottes an uns: daß dafür Geschöpfe da sind. Die äußere Voraussetzung dafür, daß Gott sie lieben kann, haben sie aber nicht von sich aus; diese Voraussetzung erschafft Gott. Und weil die göttliche Gabe ihren Geber voraussetzt, entspricht die Erschaffung der äußeren Voraussetzung für die Gabe Gottes an seine Geschöpfe besonders dem Geber, dem »Vater«.
Freilich, wenn diese drei Werke je besonders das Werk des Vaters, des Sohnes und des Geistes sind, so heißt das nicht, daß sie allein das Werk des Vaters oder des Sohnes oder des Geistes sind. Denn die Dreieinigkeit Gottes ist seine Dreieinigkeit und nicht die Existenz von drei göttlichen Wesen. Darum muß einer Aufspaltung der Werke Gottes auf den Vater, Sohn und Geist immer sofort entgegengehalten werden: Nein, der dreieinige Gott ist der Schöpfer, der Versöhner und der Heiligende. Er handelt in diesen drei Werken Gottes je anders, aber nie als ein Anderer. Wir haben es also immer, in der Schöpfung, in der Versöhnung, in der Heiligung mit dem selben Gott zu tun, mit dem Einen, der unsere Welt so geliebt hat, daß er seinen Sohn in sie gab, damit alle an ihn glauben und seine Kinder werden.
Nehmen wir an, daß wir damit in Kürze den christlichen Sinn der Trinitätslehre angedeutet und etwas davon verstanden haben, inwiefern sie, entgegen dem innerchristlichen Antitrinitarismus, unverzichtbar, aber auch nicht beliebig manipulierbar, zum christlichen Glaubensbekenntnis gehört, so stellt sich jetzt die Frage nach der Begegnung mit Judentum und Islam und ihrem kritischen Einwand gegenüber dieser Lehre.
Die Frage nach dem Sinn der Einheit Gottes
Ich blicke hier nach der Seite des Islam. Denn den Islam bestimmt der Anspruch, in Überbietung und auch in Korrektur von Judentum und Christentum das in Reinkultur zu vertreten: den Monotheismus, verstanden als Glauben an die strikte, abbildlose, unvergleichliche Einzigkeit Gottes, dem gegenüber alles Andere Nicht-Gott ist, der wohl verschiedene Eigenschaften hat, aber in sich nicht Beziehung, sondern unbewegte Einheit ist, der nach außen wohl barmherziger, gerechter, mächtiger Wille und Forderung ist, zwischen dem und uns es aber keinen Mittler geben kann, der stellvertretend für uns eintritt.
Ja, er selbst kann sich »nie in der Gestalt eines Menschen offenbaren«17. Denn »vor Allah ist Jesus Adam gleich, den er aus der Erde geschaffen« (Sure 3,60). Diesem Einzigen allein sich zu ergeben und also »muslim« zu werden, ist darum die einzig angemessene menschliche Verhaltensweise. Darum lautet die shahada, das Glaubensbekenntnis so: »Ich bekenne, daß es keinen Gott gibt außer Allah.«18. Oder mit Sure 112 – direkt gegen die Trinitätslehre gewendet: »Allah ist der alleinige, einzige und unwandelbare Gott. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt und kein Wesen ist ihm gleich.«
Wir werden diesem so vehementen Bekenntnis zur Einheit und Einzigkeit Gottes ja wohl nicht unseren Respekt versagen können. Wir werden es auch nicht unterbieten dürfen. Dürfen wir den sich so aussprechenden Islam nicht sogar als einen außerchristlichen und faktisch unchristlichen Zeugen ansehen für die unvergleichliche, unverwechselbare, unüberbietbare Besonderheit Gottes gegenüber allem, was nicht Gott ist? als einen Zeugen, den wir Christen ernstlich zu hören, durch den wir uns fragen zu lassen haben, ob wir nicht heimlich oder offen treiben, was wir schon wissen sollten, daß wir es nicht dürften, und den wir nun doch brauchen, uns vor dem zu warnen, was wir faktisch eben doch tun: Kreaturvergötterung.
Wiederum, wenn von A. Schweizer19 das Typische der reformierten Reformation gesehen wird in der Abgrenzung gegen Heidentum und Kreaturvergötzung, im Unterschied zur lutherischen Front gegen den Judaismus der Werkgerechtigkeit, so kann uns Reformierten dieser nichtchristliche Zeuge nicht ganz fremd sein. So können wir auch die kleine Bosheit, in der gewisse Lutheraner uns als Verwandte Mohammeds zu nennen pflegten, mit Humor ertragen, wohl wissend, daß wir, wenn wir in den Fußstapfen unserer Vorfahren gehen, doch auf dem Boden der Reformation stehen.
Denn das müßte uns klar sein – und hier würde ein Gespräch mit dem Islam einsetzen: daß wir und Muslime uns gerade in dem Begriff der Einheit, der Einzigkeit, der Einfachheit Gottes uneins sind. Es ist also weder so, daß wir den Begriff der Einheit Gottes aufgeben, etwa durch die Annahme, daß der dreieinige Gott eine Art Kollektiv sei. Wir werden, sofern Muslime uns das unterstellen, das in aller Ruhe als unzutreffend abweisen oder, sofern sie uns das zurecht unterstellen, uns durch sie zur Ordnung rufen lassen müssen. Noch ist es so, daß wir und der Islam uns zunächst auf dem Nenner eines Monotheismus einig wären, um erst nachträglich in Petitessen überm Strich Abweichungen zu haben. Die Differenz liegt genau in dem, daß hier und dort etwas anderes gemeint ist, wenn Gott der Eine, der Einzigartige, der Einfache genannt wird. Und hier hat die Front gegen den »Judaismus« keinen Sinn. Hier stehen wir mit dem Alten Testament und mit einem auf diesen Boden stehenden Judentum zusammen20.
Es ist aber nun eine unselige Tradition, die sagt: In einem geistig unterentwickelten Frühstadium habe Israel eine Monolatrie vertreten: die Anbetung eines Gottes, unter Annahme, es gebe noch andere Götter, bevor es dann in einem Spätstadium den Fortschritt zum geistig reifen Montheismus vollbracht habe: zu einem allgemeinen Wissen, daß das Pantheon nur einen einzigen Bewohner habe. Ich bezweifle, daß Israel an solchem Monotheismus je ein Interesse hatte. Jedenfalls ist das theologisch Interessante zunächst jene Monolatrie.
Wenn das 1. Gebot erwähnt, daß es auch noch »andere Götter« gebe, daß aber Israel sie nicht anbeten dürfe, so wird ihm damit ja nicht geboten, seinen zufälligen Stammesgott absolut zu setzen, und sei es auch nur für sich selbst. Es wird damit aufgeboten, die Selbstunterscheidung Gottes von allen anderen Göttern anzuerkennen. Wodurch unterscheidet sich aber dieser Gott von den anderen? Etwa dadurch, daß er sagt: Ich bin das Höchste, das Einzige und so das allerallgemeinste Wesen, das jenseits der vielfältigen irdischen Erscheinungen befindliche, davon nicht berührte und darum eine und einfache Sein? Nein, dadurch unterscheidet er sich von allen anderen, durch dieses »allerbesonderste«21: »Ich bin dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägypten geführt hat.«
»Ich bin dein Gott«, d.h. ich habe dich zu meinem Volk erwählt, und nicht hat dieses Volk ihn sich zu seinem Gott erwählt. Sein Wählen, sein Halten des 1. Gebots kann ja immer nur ein Anerkennen dessen sein, daß Gott es sich erwählt hat und nicht das Volk ihn. Wen der Mensch von sich aus zum Gott erwählt, ist immer ein anderer Gott. Israel würde sich, wenn es so sein Gottesverhältnis auffaßte, den anderen Völkern gleichstellen und so den Bund brechen – aber nicht aufheben. Denn »ich bin dein Gott«, der das damit beweist, daß er sich – und damit unterscheidet er sich von den anderen Göttern – mit diesem irdischen Volk verbindet, mehr noch: daß er sich auf eine zeitliche Geschichte mit diesem Volk einläßt, auf einen Weg aus der Knechtschaft mit dem Ziel seiner Befreiung.
Ganz im Unterschied zu der Meinung, daß wir umso unfehlbarer von Gott reden, je geistiger, je gereinigter von allem Irdischen und Zeitlichen wir ihn denken, ist diesem Gott in seinem Umgang mit Israel Menschliches nicht fremd. F. Rosenzweig bemerkte zurecht, der Anthropomorphismus gehöre unlöslich zum Glauben Israels an seinen Gott22. Und also dadurch unterscheidet sich Gott von den anderen Göttern, dadurch ist er der Eine und Einzige, an den sich sein Volk allein zu halten hat: daß er, indem er sich in bestimmten Taten erweist, untrennbar von diesen Taten ist. Die Einheit und Einzigkeit dieses Gottes ist ganz und gar die unvergleichliche Souveränität und Verläßlichkeit Gottes in seinem Handeln und Reden.
Der spätere »Monotheismus« in Israel ist nur ein Pünktlein auf das i dieser Erkenntnis. Er steht quer zur aufklärerischen Belehrung darüber, daß es vernünftigerweise nur ein höchstes Wesen gebe und daß sich die verschiedenen Religionen auf dem Nenner dieses Einen als verschiedene Wege zu diesem Einen zu verstehen hätten. Vielmehr bekommt in Israels Monotheismus sein Glaubensbekenntnis einen höchst polemischen Charakter und behauptet nun die Nichtigkeit der augenscheinlich immer noch allzu realen anderen Götter.
Man bedenke, Israel bekannte das in einer Situation, in der ihm aller Übermut fernlag, in der sein nacktes Überleben unter den Völkern am seidenen Faden hing, in der es in Versuchung stand, im Sieg der anderen Völker über es den Machtbeweis ihrer Götter gegenüber dem Gott Israels anzuerkennen. Wenn es jetzt bekannte, daß diese mächtigen anderen Götter Nichtse sind, so war das die begnadete Erkenntnis, wen es an seinem Gott hat, jetzt, wo Israel nichts übrig blieb als die Hoffnung allein auf ihn.
Es war die Erkenntnis, daß dieses von allen verlassene »Würmlein Jakobs« (Jes. 41,14) nicht von Gott verlassen ist, darum nicht, weil nicht Israel ihn erwählt hat, so daß dann mit Israels Untergang auch sein Gott unterginge, das darum, weil Gott es erwählt hat und weil darum jener seidene Faden nicht reißt. Es war von da aus die religionskritische Einsicht (Jes. 41,6–20), daß die mächtigen Götter seiner Umwelt Spiegelbilder des Machtwillens dieser Völker sind, daß ihre Götter von ihnen selbst gemacht sind, daß sie in ihnen nur ihr Produkt anbeten. Es war die Einsicht, daß das, was den Gott Israels von den anderen unterscheidet – daß er sich sein Volk erwählt hat und nicht von ihm zum Gott gewählt ist – ihn nicht nur von den anderen Göttern unterscheidet, sondern diese vergehen läßt23.
Das Neue Testament nimmt nichts von dem allen weg. Es greift das alles auf, aber spitzt das in einer für es unerläßlichen Weise zu. 1. Kor. 8,4ff.: »Wir wissen, daß es keine Götzen gibt und kein Gott ist außer dem Einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden – wie es in der Tat viele Götter und Herren gibt –, so gibt es für uns nur einen einzigen Gott: den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und« – jetzt kommt die Zuspitzung: »den einen, einzigen Kyrios Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn.« Das heißt nicht, daß es zwei Eine und Einzige gebe. Die Aussage liegt strukturell auf der Linie des Alten Testaments, die sie ja zunächst zusammenfaßt: Gottes Einheit und Einzigkeit ist kein metaphysisches Einzelner-Sein jenseits aller Welt, das ein Prophet uns kundtut. Gott ist einzig und Einer in seinem konkreten Handeln und Reden.
Das Neue Testament sagt darüber hinaus, daß Gott in diesem Reden und Tun so dem von ihm erwählten Israel zugewendet ist, daß er Einen aus diesem Volk in die Einheit mit sich genommen. Ja, er hat in diesem Einen elende, fluchwürdig sündige Gestalt wirklich angenommen, so daß keine Sünde von ihm scheiden kann, so daß darum nun auch Heiden Zugang zur Teilnahme an diesem Volk haben. Das 1. Gebot heißt im Neuen Testament: Du sollst keinen Gott haben außer diesem, den nicht wir erwählt haben, der aber in seiner unüberbietbaren Gnade sich menschliche Gestalt zur Einheit mit sich gewählt und angenommen hat. Gott ist der Eine, der Unvergleichliche, der Unüberbietbare in diesem Einen, für uns gestorbenen und auferstandenen Kyrios (Herrn und Gottessohn). Und sofern dieses Christusbekenntnis die Wurzel der Trinitätslehre ist, läßt sich jetzt auch kurz sagen: Gott ist der Eine gerade als der Dreieinige und als der Dreieinige der wahrhaft Eine.
Von da aus blicken wir auf das Bekenntnis des Islam: Wird nicht in der Tat hüben und drüben mit der Einheit und Einzigkeit Gottes etwas sehr Anderes gesagt? Ist dort die angegebene Reinheit der Aussage von Gottes Einheit und Einzigkeit nicht dadurch erkauft, daß Gott gereinigt wird von allem wirklichen Umgang mit bestimmten Menschen in einer bestimmten Geschichte? Ist er darum nicht notwendig der Eine, statt in seinem handelnden und redenden Umgang mit diesen Menschen, in einem abstrakten Jenseits des Kreatürlichen? Und ist darum jener Mono-theismus nicht der Kult um eine eigentlich leere, neutrale Gottheit? Nährt sich dieser Monotheismus nicht vom Zauber der Zahl 1 und von der Meinung, daß Einheit als solche etwas Göttliches sei?
Als ob es nicht auch eine sehr fragwürdige Einheit gäbe! Und kann es von einer Definition Gottes durch solches Einer-Sein her jene religionskritische Einsicht geben, wenn sich der irdische Machtwille von Völkern im Bild eines einzigen Gottes sein Spiegelbild schafft? Wir müssen jedenfalls sagen, daß uns gerade die Einheit Gottes – die Einheit des an uns handelnden und zu uns redenden, dreieinigen Gottes – hindert, einen solchen Monotheismus zu bejahen und als gemeinsamen Nenner des koranischen und biblischen Zeugnisses anzuerkennen.
Wiederum, sobald anerkannt wird, daß Gott der Eine ist in seiner Zuwendung und Offenbarung, sobald ist schon im Ansatz mitgesagt, daß die Gestalt und Wirkung seiner Offenbarung zu ihm selbst gehört. Es war daher übrigens nicht zufällig, daß es auch im frühen Judentum unternommen wurde, in einer Dreiheit von Gott zu reden: etwa in Anknüpfung das »Dreimal-Heilig« von Jesaja 6,324 oder in der Rede von der Göttlichkeit der Tora und der Weisheit25.
Die Frage nach dem Sinn der Menschwerdung Gottes
Es geht jetzt um unsere Beziehung zum Judentum. Aus ihm hören wir ja ein Nein zu dem, was das Neue Testament bezeugt und was die Wurzel der Trinitätslehre ist: daß in dem einen Jesus, dem Christus, das ewige Wort Gottes, das Gott selbst ist, Mensch wurde. Es sei erinnert an die Verwahrung Bubers gegen den christlichen Satz einer göttlichen Inkarnation, weil Gott jeder seiner Manifestationen überlegen sei. Man stutzt bei diesem Argument. So richtig es ist, daß daraus, daß Gott sich bindet, nicht folgt, daß wir Gott an uns binden können, so tönt das Argument eher nach einem liberalen Relativismus denn nach einem biblisch gebundenen Denken.
Wenn Gott Israel das Versprechen gibt: »Ich will euer Gott und ihr werdet mein Volk sein«, so ist das doch eine Manifestation Gottes, in der er sich als der Überlegene sehr wohl bindet, ohne sich vorzubehalten, diese Bindung eventuell aufzuheben. Ohne das Faktum der Selbstbindung Gottes zu sehen, werden wir weder das Alte noch das Neue Testament jemals recht verstehen. Und eine Lehre vom Künftigen, dessen Noch-nicht-Angebrochensein Buber da wohl behaupten will, steht auf abgesägten Füßen, wenn sie auf dem Zweifel an dem Faktum von Gottes Selbstbindung errichtet ist.
Doch hat jüngst M. Wyschogrod jenem Argument Bubers widersprochen, mit der sich weit herauswagenden These, »daß sich die jüdische Abneigung gegen eine Inkarnationstheologie nicht auf A priori-Gründe berufen kann, als gäbe es etwas im Wesen der jüdischen Gottesvorstellung, das sein Erscheinen in Menschengestalt zu einer logischen Unmöglichkeit machte.« Von mehr als einer Möglichkeit spricht er nicht. Daß Jesus der Christus, daß er die Wirklichkeit dieser Möglichkeit ist, »daß Jesus Gott war«, möchte er damit nicht sagen; sonst würde er zwar nicht aufhören, Jude zu sein, aber dann wäre er ein christlicher Jude26.
Freilich deutet er nicht auch nur an, was denn die Wirklichkeit dieser Möglichkeit bedeuten würde, auch für Juden selbst und dann auch für Nichtjuden. Vielmehr biegt er, wenn ich recht sehe, auch nur die Frage danach ab mit einem Gedanken, der die Wirklichkeit dieser Möglichkeit überhaupt überflüssig macht. Denn darin besteht nach ihm diese Möglichkeit, daß »Gott in allem jüdischen Fleisch ist«, inkarniert ist; und nur insofern war auch »in Jesus Gott«27. Damit macht Wyschogrod zwar mehr als Buber das Versprechen Gottes klar: »Ich will unter den Kindern Israel wohnen und ihr Gott sein« (Ex. 29,45).
Trotzdem kommt er zuletzt zum selben Ergebnis wie Buber: Weil in allen Gliedern Israels schon Gott inkarniert ist, bedarf es keiner besonderen Inkarnation Gottes in Jesus Christus. Darum ist die in ihm nur eine unter anderen Inkarnationen Gottes in Israel. Darum ist die in ihm nichts Neues für Juden – und es ist aus dieser Sicht fraglich, warum sie für Christen noch in etwas anderem besteht, als was er unter Inkarnation versteht: daß Gott, unter den Israeliten wohnend, ihr Gott ist. Aber das bedeutet nun doch nicht geradezu, daß Israel Gott »in Menschengestalt« ist.
Dafür schiebt er uns die Beweislast zu: die Erklärung dessen, daß Inkarnation Gottes im Falle Jesu Christi nicht bloß heißt, daß Gott in ihm wie in in allem jüdischen Fleisch ist, daß Gott in ihm so ist, daß von ihm zu sagen ist: »daß Jesus Gott war«, wie Wyschogrod formuliert. Wir dürfen uns um den von ihm bezeichneten Punkt nicht drücken, haben aber die Sache anders zu formulieren. Die reformierte Dogmatik hat seit je im Unterschied zur lutherischen sich davor gescheut, den Menschen Jesus mit Gott zu identifizieren: in Sorge, es könnte so zu einer Jesulatrie, zu einer – womöglich noch durch unsere Wertschätzung vorgenommenen – Vergottung eines, dieses Menschen kommen.
Auch hier dachte sie nicht in jener Front gegen den Judaismus; und hier liegt wohl der tiefste Grund, warum lutherische Polemik die Reformierten nicht nur zu den Muslimen, sondern auch zu den Juden stellte: Calvinus judaizans, hieß das einst: »der judaisierende Calvin«. Sie haben sich dieses Vorwurfs nicht zu schämen. Sie haben aber Auskunft zu geben, inwiefern wir mit der älteren reformierten Dogmatik zwar nicht den Menschen Jesus mit Gott zu identifizieren, aber zu bekennen haben, daß Gott sich mit diesem Menschen ineinsgesetzt hat, nicht nur verbündet wie mit ganz Israel. Sie hat Auskunft zu geben, daß Inkarnation Gottes z.B. im Sinne Wyschogrods und die in Joh. 1,14 bezeugte Fleischwerdung des Wortes nicht dasselbe ist.
Inwiefern? Mit 1. Kor. 5,19f.: »Gott war in Christus« (das redet von Gottes Einwohnung, an der Wyschogrod liegt und die ja dann das christologische Stichwort der antiochenischen Schule in der Alten Kirche war, in deren Spuren die älteren Reformierten dachten, aber): Gott war so in Christus, daß »Gott in ihm die Welt versöhnte mit sich selbst ... Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.« Wenn das ein Spezialfall von Einwohnung Gottes in Israel ist, so doch einer, der den »Normalfall« solcher Einwohnung in ein neues Licht stellt.
Denn was man auch von Israel als Bundespartner Gottes sagen mag, das nicht, daß in ihm Gott in die Welt zu ihrer Versöhnung mit Gott kommt, daß Gott Israel, das von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir Gerechtigkeit vor Gott würden. Die Inkarnation Gottes in Jesus Christus zur Versöhnung der Welt in ihm mit Gott, von der Paulus redet, gilt nach ihm jedenfalls auch für Israel, gilt sogar »den Juden zuerst und dann und darum auch den Griechen«, den Völkern (vgl. Röm. 1,16f.). In dieser Versöhnung ist Gott zweifellos für die Juden und nicht gegen sie, aber in ihr tritt er so für sie ein, wie sie nicht für sich selbst, geschweige für die übrige Welt, eintreten können.
Greifen wir zur weiteren Klärung dessen direkt auf die Trinitätslehre zurück und heben dabei jetzt erst recht ihren evangelischen Sinn hervor! Es fällt auf, daß die Bestreitung dieser Lehre auf protestantischem Boden nur die Folge der Bestreitung zunächst einer anderen Lehre war: der Erkenntnis, daß wir unser Heil, unsere Zugehörigkeit zu Gott weder ganz noch teilweise unserem Tun, unserer Würdigkeit, unserem Vermögen dazu verdanken, sondern ganz und gar und restlos der Gnade Gottes. Da besteht ein Zusammenhang: Offenbar darum, weil die Gnadenlehre bestritten wurde, wurde dann auch die Trinitätslehre bestritten. Und umgekehrt verstehen wir es nun, warum die Reformation nach ihrer Neuentdeckung der Gnadenbotschaft dann sogleich auch das zunächst zurückgestellte Bekenntnis der Dreieinigkeit Gottes als nicht preiszugebende Erkenntnis hervorhob.
Wie eng beides zusammenhängt, sagt kurz und gut das Bekenntnis ostfriesischer Prädikanten von 1528: »Wir glauben allein an Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, das heißt: wir bekennen und bekommen Vergebung unserer Sünden, die ewige Rechtfertigung und Seligkeit allein durch Gott den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erden, allein durch den Sohn, unserern Mittler Jesus Christus, allein durch die Versicherung des Heiligen Geistes, unseres Trösters. Wir sagen in dieser Beziehung allem ab, was nicht Gott selbst ist und tut, und halten anderes nicht für nötig zu
unserer Seligkeit.«28
Inwiefern besteht da ein innerer Zusammenhang? Inwiefern ist das Bekenntnis zur reinen Gnade Gottes als solches das Bekenntnis zum dreieinigen Gott und umgekehrt? Darauf stößt uns der hellsichtige Satz K. Barths: »Der Gott aller synergistischen Systeme ist das Absolute, die Zahl 1.«29 Denn wo Gott im Sinn der »Zahl 1« gedacht wird – und schreibe man ihm noch so gnädige Eigenschaften zu –, da kann sich dieser einsame Gott nicht mit uns von ihm Verschiedenen in Verbindung bringen, es sei denn mit unserer freundlichen Unterstützung. Ohne daß wir ihm mit unserem natürlichen, religiösen oder moralischen Vermögen entgegenkommen, wie es ja der Synergismus sagt, wird Gott uns ewig einsam als bloße »Zahl 1«, als Absolutes, d.h. von uns Losgelöstes fern gegenüberstehen.
Sagen wir aber, daß wir allein von Gottes Gnade leben, dann sagen wir eben damit: Wir leben davon, daß Gott uns nicht nur gnädig ist, daß er uns auch seine Gnade mitteilt und vermittelt. Wir leben davon, daß Gott uns zuvorkommend liebt (der »Vater«), und zwar so, daß er uns mit seiner Liebe entgegenkommt (der »Sohn«) und in uns hineinkommt (der »Geist«). Oder mit den Worten von vorhin: Daß Gott der »Vater« zum Beweis seiner Liebe seinen »Sohn« gibt und uns im »Geist« zu seinen Kindern macht, das ist alles das Werk allein seiner Gnade, das ist alles das Werk Gottes an uns. Das ist alles sein Werk und seine Gnade, indem also Gott auch in der Mitteilung seiner Gnade (im »Sohn«) wie in ihrer Vermittlung (im »Geist«) noch einmal Gott selbst und nicht weniger als Gott ist.
Erst wenn wir uns diesen unlöslichen Zusammenhang von Trinitäts- und Gnadenlehre klarmachen, wird uns ein weiteres deutlich. Wir sahen ja, daß die älteren Antitrinitarier anscheinend auch nicht zufällig für die Ausscheidung des Alten Testaments aus der christlichen Bibel eintraten, – während die Trinitarier kühnlich behaupteten, daß der dreieinige Gott schon der Gott des Alten Testaments und daß dieses darum nicht preiszugeben ist. Die Art, wie sie dabei zum Nachweis dessen dort auf einzelne Bibelstellen tippten, war gewiß fragwürdig – Calvin war zwar in dieser Hinsicht für seine Zeitgenossen immerhin aufreizend skeptisch30, doch ohne daß auch er bestritten hätte, daß der Dreieinige schon der Gott Israels ist. Ich denke, daß das Anliegen in dieser Sache nicht preiszugeben ist.
Ich denke aber auch, daß dieses Anliegen noch einmal neu durchdacht und besser durchgeführt werden muß. Um noch einmal an jenen Schlüsselsatz zu erinnern: »Darum wurde Gott Mensch, damit wir Menschen die Seinen würden«! In dem Satz fehlt eine Besinnung darüber, was das bedeutet, daß Gott in Christus doch nicht zufällig jüdischer Mensch und nicht allgemein Mensch wurde. Indem der Satz augenscheinlich auf die Bundesverheißung an Israel anspielt, fehlt die Besinnung darüber, wie sich der Satz denn zu dem Versprechen an Israel verhält: »Ich will euer Gott und ihr werdet mein Volk sein.« Hat mit dem, was jener Satz sagt, etwa Gott dieses Versprechen gekündigt? Oder wenn nicht, wie kommen »wir« aus den Gojim, den Heiden dazu, uns als zum Bundesvolk Gottes hinzuberufen zu wissen?
Hier haben wir nicht vor allem Dialoge zu führen, sondern in uns zu gehen und zu versuchen, die Sache besser als zuvor zu sagen. »Ich will unter den Kindern Israels wohnen und ihr Gott sein« – »der ich in der Höhe wohne und bei den Zerschlagenen« (Jes. 57,15). Was heißt denn das? Dieses Wohnen Gottes ist offenbar die Gnadengegenwart Gottes in Israel, die nicht weniger als Gott ist, sondern der ewige Gott in seiner Gegenwart,die Israel als sein Volk nicht vorfindet, sondern die es schafft als das Volk, mit dem Gott im Bunde ist, die es somit sich erschafft als seinen »Sohn« (Dtr. 1,31), als »das Werk seiner Hände« (Jes. 45,11).
Und nun halte ich K. Barths Satz für hilfreich: »Die (Christus-)Versöhnung ist die Erfüllung des Bundes.«31 Das sagt, daß diese Versöhnung im Rahmen des Bundes stattfindet. In ihr nimmt die Gnadengegenwart Gottes in seinem Volk die Gestalt an, daß Gott selbst – in Jesus Christus – so für sein bundesbrüchiges Volk eintritt, daß kein Bundesbruch es mehr von seiner Liebe trennen kann. So wird der Bund erfüllt, unanfechtbar gemacht: indem sich Gottes Bundesgnade als Gnade für verlorene Sünder betätigt. Der Bund wird dadurch erfüllt und nicht etwa durch einen anderen ersetzt. Er erfährt gerade hier seine göttliche Bestätigung, ohne die der Bund nicht bestehen könnte, kraft deren er aber definitiv ist. Aber weil er definitiv wird kraft der Gnade Gottes für verlorene Sünder, sind nun auch die noch verloreneren Sünder, die aus den Gojim nicht mehr »Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen« in seinem Bund (Eph. 2,19).
Ihre Berufung in die Kirche Jesu Christi bezeugt die in ihm geschehene Erfüllung des Gnadenbunds. Nicht ein anderer Gnadenbund als der mit Israel wird mit ihnen geschlossen; »nur um ihre Einbeziehung in den einen Bund kann es sich handeln.«32 Wenn es richtig ist, daß die Trinitätslehre Konsequenz der Erkenntnis der reinen, ganzen Gnade Gottes ist, dann haben wir nicht bloß zu sagen, daß von der Gnade des dreieinigen Gottes Israel nicht ausgeschlossen ist. Dann haben wir von Gnade zu sagen, daß wir von ihr nicht ausgeschlossen sind. Und dann können wir gerade kraft der Gnade des dreieinigen Gottes uns zur Gemeinschaft mit den Juden bekennen.
---
1. Der Spiegel, 11.4.1994, S. 215f.
2. Moses Maimonides, Ein Querschnitt durch sein Werk, Köln 1966, S. 97.
3. Genesis des Antisemitismus. Vor und nach Christus, Wien/ Frankfurt/ Zürich
1969, S. 145.
4. E.F.K. Müller, Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, Leipzig 1903, S. 221.
5. Auslegung der Heil. Schr., Bd. 2 (2.–5. Mose), Neukirchen o. J., S. 284.
6. Sure 5, 18 und: 48f.
7. In: R.R. Geist / H.J. Kraus, Versuche des Verstehens, TB 33, München 1966, 159.
8. Vgl. J. Koopmans, Das altkirchliche Dogma in der Reformation, BET 22, München 1955.
9. Zum folgenden vgl. RE3, Bd. 18, S. 469–480.
10. Das Wesen des Christentums, Leipzig 1900, S. 125.128. Die Zahlen im Text bezeichnen die Seiten des Werks.
11. A. von Harnack, Aus der Werkstatt des Vollendeten, Gießen 1930, S. 128. 63; ders., Dogmengeschichte, Tübingen 19226, S. 60.
12. Harnack, Wesen, S. 137.
13. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Tübingen 19094, Bd. 2, S. 90.
14. Fünf Bücher gegen die Häresien, III, 8.3.
15. Vgl. Anm. 2.
16. Vgl. Athanasius von Alexandrien, Über die Menschwerdung des Logos, 54.
17. J. Bouman, Das Wort vom Kreuz und das Bekenntnis zu Allah. Die Grundlehren des Korans als nachbiblische Religion, Frankfurt 1980, S. 263.
18. AaO S. 15.
19. A. Schweizer, Die christliche Glaubenslehre, Bd. 1, Zürich 1863, S. 8f.
20. Vgl. zum Folgenden: K.H. Miskotte, Der praktische Sinn von Gottes Einfachheit, in: ders., Der Gott Israels und die Theologie, Neukirchen-Vluyn 1975, S. 19–43;
und: K. Barth, Kirchliche Dogmatik II/1, S. 495–518.
21. Miskotte, aaO S. 34.
22. Die Rede von Gott in menschlicher Gestalt! F. Rosenzweig, Kleine Schriften, Berlin 1937, S. 525ff.
23. K. Barth hat den Sinn dessen kongenial erfaßt, als er 1940 auf dem Höhepunkt der Machtentfaltung Hitlers und seiner Scharen erklärte: »An der Wahrheit des Satzes, daß Gott Einer ist, wird das dritte Reich Adolf Hitlers zu Schanden werden« (Kirchliche Dogmatik II/1, S. 500).
24. A. Adam, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd.1, Gütersloh 1965, S.117–120.
25. Vgl. Art. Torah, in: Encyclopaedia Judaica XV, Jerusalem 1971, Sp. 1235–1246.
Für den Juden D. Lasker ist zwar die christliche Lehre von der Inkarnation, aber Trinität »an sich keine unannehmbare Lehre« – nach C. Thoma / M. Wyschogrod, Das Reden von dem einen Gott bei Juden und Christen, Bern 1984, S. 74f. Vgl. die einsichtsvolle Arbeit von D. Neuhaus, Ist das trinitarische und christologische Dogma in der Alten Kirche antijudaistisch?, in: Mit unsrer Macht ist nichts getan. FS D. Schellong, hg. von J. Mertin u.a., Frankfurt 1993, bes. S. 264.
26. M. Wyschogrod, Inkarnation aus jüdischer Sicht, EvTh 55 (1995), S. 13–28, dort S. 23.
27. AaO S. 26.
28. E.F.K. Müller, Bekenntnisschriften, S. 934.
29. Kirchliche Dogmatik III/3, S. 157.
30. J. Koopmans, Das altkirchliche Dogma in der Reformation, München 1955, S. 121.
31. Kirchliche Dogmatik IV/1, S. 22.
32. K. Barth, Kirchliche Dogmatik I/2, S. 115.
Abgedruckt in: Eberhard Busch, Verbindlich von Gott reden. Gemeindevorträge, Neukirchen-Vluyn, Wuppertal, 93-110.
Prof. Dr. Eberhard Busch
Eberhard Busch, Trinitätslehre und interreligiöser Dialog als Word-Datei zum Download