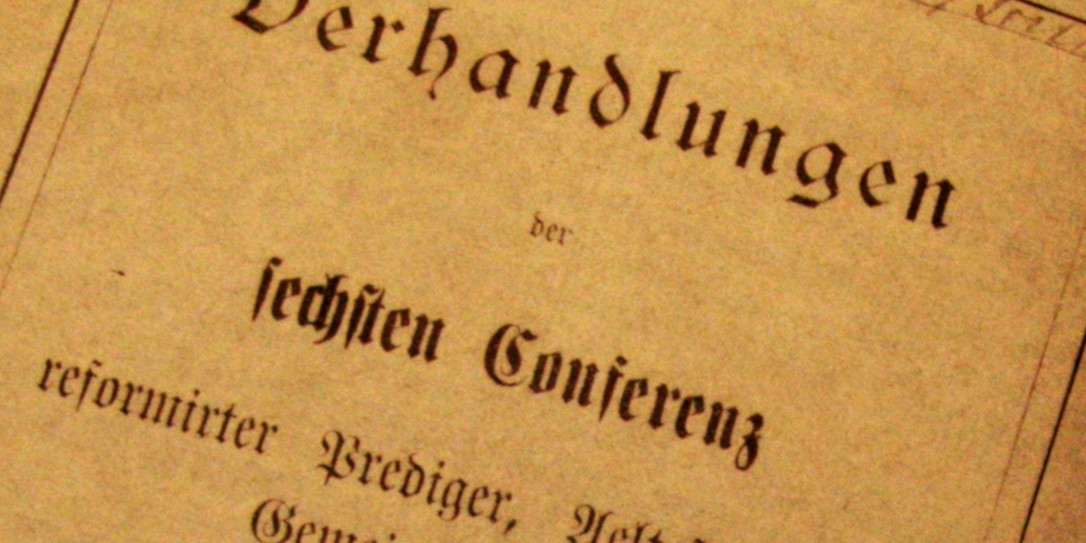Wichtige Marksteine
Reformierte im Spiegel der Zeit
Geschichte des Reformierten Bunds
Geschichte der Gemeinden
Geschichte der Regionen
Geschichte der Kirchen
Biografien A bis Z
(1528–1572)
Jeanne d´Albret (1528–1572) war die bedeutendste Frau in der Geschichte der Hugenotten im 16. Jahrhundert. Besonders in ihrem Witwenstand, in den letzten zehn Jahren ihres Lebens, baute sie eine reformierte Kirche in Béarn auf und war das politische Oberhaupt der Hugenotten im dritten Religionskrieg (1568–1570). Nach 1570 versuchte sie, die Reformierten zu schützen und ihnen einen gesicherten Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. Sie handelte für die Hugenotten den Friedensschluss von St. Germain 1570 aus, und durch die Heirat ihres Sohnes Heinrich (später Heinrich IV. von Frankreich) mit Margarete von Valois, Schwester des Königs Karl IX. von Frankreich, strebte sie eine enge Verbindung von Hugenotten und Katholiken an.
Keine andere Frau hatte eine solche Machtposition unter den Hugenotten in Frankreich inne. Sie war respektiert und gefürchtet in Rom und Madrid, alliiert mit Elizabeth von England und befreundet mit Katharina von Medici – keine unkomplizierte Freundschaft zwischen zwei starke Frauen.
Sie sorgte dafür, dass ihre Kinder – Heinrich und Katharina – im reformierten Glauben erzogen wurden. Jahrelang kämpfte Heinrich als Anführer der Hugenotten und von einer Machtbasis in Südfrankreich aus um die französische Krone, bis er 1589 König von Frankreich wurde und schließlich 1593 zum katholischen Glauben übertrat, um das Land zu befrieden.
Jeanne d´Albret war nicht nur Mutter ihres berühmten Sohnes, sie war auch selbst eine machtvolle Frau in Frankreich, da ihre Position als Anführerin der Hugenotten ihr einen Einfluss weit über die Grenzen ihres kleinen Königreiches zusicherte.
Jugend und Ehe (1528-1555)
Jeanne d´Albret wurde am 7. November 1528 auf dem Schloss Blois von Margarete und Heinrich II. von Navarra geboren. Ihre Mutter wusste angeblich, dass sie eine Tochter gebären würde, ihr sehnlichster Wunsch war freilich nach einem Sohn. Jeanne blieb das einzige Kind aus dieser Ehe, Margarete von Navarra gebar zwar kurz danach einen Sohn, der als Kleinkind starb, und alle übrigen Hoffnungen auf Schwangerschaften zerschlugen sich.
Die kleine Prinzessin konnte von ihrem Vater das Königreich Navarra erben, weil dort das salische Gesetz, das in Frankreich weibliche Thronerben verbot, nicht gültig war. Außerdem war das vicomté Béarn selbständig. Deswegen waren die zwei Großmächte Spanien und Frankreich zutiefst an diesen Grenzregionen interessiert. Frankreich wollte seine Südgrenze verteidigen, und Spanien beide Seiten der Pyrenäen besitzen, um in Frankreich einfallen zu können. Zudem war die väterliche Familie von Albret Großgrundbesitzer in Südwestfrankreich und damit Vasall des französischen Königs. Das frühere Aquitanien hatte mehrere hundert Jahre der englischen Krone gehört und war spät von England aufgegeben worden. Im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet meistens als Guyenne bezeichnet.
In ihren jungen Jahren wuchs Jeanne in der Normandie auf. Ihre Mutter, Margarete von Navarra, hatte die Aufgabe, die königlichen Kinder ihres Bruders, Franz I., zu erziehen. Sie gab Jeanne in die Obhut ihrer Freundin Aymée de Lafayette, Vogtin von Caen. Man behauptet, sie sei die Vorlage für die Figur Longarine in Heptameron (vgl. Nielsen). Nach meiner Auffassung sind die Erzähler/innen im Heptameron, die sogenannten devisants, eher Typen als historische Persönlichkeiten, die Figur der Longarine ist allerdings eine sehr sympathische Frau mit Humor und Pfiff. Wenn Aymée de Lafayette die Vorlage zu Longarine abgegeben haben soll, deutet alles darauf hin, dass Margarete sie sehr schätzte und meinte, ihre Tochter sei bei ihr gut aufgehoben.
Jeanne wuchs in einem landadligen Milieu auf, umgeben von Wald, Wiesen und Tieren, mit den Mitgliedern der Familie von Aymée de Lafayette als Bezugspersonen, bis sie zehn Jahre alt war. Ihre Mutter sah sie selten, aber jedes Mal, wenn sie krank war, war Margarete sofort zur Stelle. 1538 ließ Franz I. sie nach Plessis-lez-Tours bei der Loire übersiedeln, da sie jetzt ein Alter erreicht hatte, wo sie auf dem Heiratsmarkt von Interesse war. Der König konnte über seine Verwandte entscheiden und Ehen arrangieren, wie es ihm passte.
1540 war es für Jeanne so weit. Herzog Wilhelm der Reiche von Kleve-Jülich-Berg hatte 1538 das Herzogtum Geldern geerbt. Sein Erbanspruch wurde von Kaiser Karl V. angefochten und auf dem Reichstag zu Regensburg wurde dem Kaiser Geldern zugeteilt. 1539 folgte Wilhelm seinem Vater auf dem Thron nach, und um sich vor den Ansprüchen des Kaisers zu schützen, arrangierte er eine Ehe mit Heinrich VIII. von England für seine Schwester Anna, und selbst verbündete er sich mit Franz I. Als Unterpfand für dieses Bündnis sollte er Jeanne d´Albret heiraten.
Was jetzt passierte, ist absolut ungewöhnlich: Jeanne weigerte sich. Die Zwölfjährige ließ ihrem Onkel wissen, dass sie den Herzog nicht heiraten möchte, und sie ließ zwei Schreiben aufsetzen, in welchen sie erklärte, dass sie gegen ihren Willen zu dieser Ehe gezwungen worden sei. Natürlich konnte sie sich nicht auf Dauer gegen den Willen des Königs auflehnen, aber bei der Hochzeitszeremonie am 14. Juni 1541 weigerte sie sich, zum Altar zu schreiten, stattdessen musste sie getragen werden. Ihr Jawort war nicht hörbar und wegen ihres Alters wurde die Ehe nicht vollzogen, der Herzog setzte nur symbolisch ein Bein in ihr Bett. Nach der Hochzeit kehrte er zurück nach Düsseldorf, während Jeanne vorläufig in Frankreich blieb.
1543 griff Kaiser Karl Kleve-Jülich-Berg an, der Herzog wurde geschlagen und musste Geldern Karl V. überlassen. Am Frieden von Venlo im September 1543 hob er das Bündnis mit Franz I. auf und verbündete sich stattdessen mit dem Kaiser. Damit war auch die französische Ehe hinfällig geworden, 1545 wurde sie vom Papst wegen Nichtvollzug annulliert, und der Herzog vermählte sich mit einer Nichte des Kaisers.
Nach kanonischem Recht durfte bei einer Eheschließung keine Zwang im Spiel sei. Die Eheleute mussten ihr Gelübde frei abgeben. Damals konnten junge Frauen aus adligen oder königlichen Familien sich ihre Ehepartner nicht selbst aussuchen, sondern wurden als politische Garanten vermählt, und die meisten fanden sich damit ab, weil das ihr Standesbild entsprach. Jeannes Ablehnung, so wie ihre Kenntnis des kanonischen Rechts, ist erklärungsbedürftig.
Eine mögliche Erklärung ist, dass ihre Eltern für sie eine Ehe mit dem Kronprinzen Philipp von Spanien anstrebten. Königin von Spanien war natürlich prestigeträchtiger als Herzogin von Kleve zu sein, aber vor allem erhoffte sich ihr Vater damit den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. 1512 hatten die Spanier Navarra, das Baskenland, bis zu den Pyrenäen erobert und den Albrets nur das winzige Gebiet auf der französischen Seite gelassen. Seitdem überlegten sich die Könige von Navarra, wie sie zu ihrem ganzen Erbe kommen konnten, und eine Ehe zwischen dem Infanten von Spanien und der zukünftigen Königin von Navarra würde genau dies herbeiführen.
Jeanne war möglicherweise auch beeinflusst von einer Erklärung der Ständeversammlung von Béarn, die eine auswärtige Ehe für ihre Kronprinzessin ablehnte.
Sah Jeanne d´Albret ihre Zukunft gefährdet durch eine Ehe mit dem Herzog von Kleve? Oder tat sie, was ihre Eltern wünschten, statt des Königs Willen zu erfüllen? Stammten ihre Kenntnisse des kanonischen Rechts von denen? Margareta von Navarra schrieb ihrem Bruder, sie habe keine Ahnung, was in das Mädchen gefahren sei, aber stimmt das? Hat sie Jeanne mit ihrer Ablehnung der Ehe geholfen aus Liebe (Cholakian & Cholakian), oder aus Ehrgeiz? Es besteht kein Zweifel, dass königliche Kinder damals frühreif waren und in jungen Jahren schon an ihre späteren Aufgaben geführt wurden, trotzdem ist die Zähigkeit und Sturheit des Mädchens erstaunlich.
1547 starb Franz I. und als Jeanne zwanzig Jahre alt war, bot der Nachfolger, Heinrich II. von Frankreich, ihr gleich zwei Heiratskandidaten an: den Herzog Franz von Aumale (der spätere erzkatholische Herzog Franz von Guise) und Anton von Bourbon, Herzog von Vendôme. Der letztere war Erbprinz und vielleicht deshalb für Jeanne die bessere Partie, obwohl er relativ arm war. Er war hochgewachsen – was für einen Bourbon eher selten war – und charmant, wie alle Männer in seiner Familie scheint er ein unverbesserlicher Schürzenjäger gewesen zu sein. Heinrich IV. von Frankreich, der vert galant, hatte seine ausgelebte Sexualität nicht von Fremden, ebenso wenig wie sein militärisches Können und seinen Mut.
Jeanne und Anton von Bourbon heirateten 1548 und sie war überglücklich. Heinrich II. schrieb in einem Brief, dass er selten eine Braut erlebt habe, die immer nur lachte. Diese Ehe war aus Liebe geschlossen, und Anton von Bourbon nahm seine Frau mit, als er in den Krieg zog. Der Kriegsschauplatz war Flandern, und da der Herzog Güter in Nordfrankreich besaß, zog Jeanne in den ersten Jahren ihrer Ehe von Schloss zu Schloss, immer in der Hoffnung, dass sie und Anton von Bourbon sich treffen könnten.
1551 gebar sie ihren ersten Sohn und gab ihn an Aymée de Lafayette, die sie selbst erzogen hatte. Ob nun Frau de Lafayette alt oder übervorsichtig geworden war, der kleine Herzog von Beaumont starb als Kleinkind, angeblich weil er von Wärme erstickt worden sei.
Bald wurde Jeanne wieder schwanger, und während ihr ältester Sohn in Nordfrankreich geboren war, sollte das zweite Kind in Béarn zu Welt kommen. Sie unternahm die lange Reise nach Süden und kam gerade rechtzeitig in Pau an, 14 Tage bevor sie von ihrem zweiten Sohn, Heinrich, auf dem Schloss in Pau entbunden wurde. Es wurde entschieden, dass dieser Junge in Pau bleiben sollte. Der Großvater, Heinrich d´Albret, wollte wahrscheinlich mit diesem kleinen Prinzen die Erbfolge in Béarn und Navarra sichern. Die Legenden von der rauen Erziehung Heinrichs seitens des Großvaters können jedoch nicht wahr sein, allein weil das Kind die ersten Jahre von Ammen betreut wurde, und der Großvater starb, als es zwei Jahre alt war. Es scheint in Béarn Sitte gewesen zu sein, die Lippen des Täuflings mit Rotwein und Knoblauch einzureiben, eine Taufe à la Gascogne, aber die Mär, dass Heinrich barfuß unter den Hirten in den Bergen aufgewachsen sein soll, ist reine Legende. Der spätere Hauslehrer Heinrichs, Palma Cayet, schrieb, als Heinrich schon König von Frankreich war, seine Biographie, und daher stammt der Bericht vom Opa und von seiner rauen Erziehung. Dieser Kindheitsbericht ist eher Propaganda des Königs, wie er gerne gesehen werden möchte.
Tatsächlich kam Heinrich in die Obhut der Familie de Miossens, die auf dem Schloss Coarraze wohnte. Die Frau, Suzanne de Bourbon-Miossens, war eine Cousine von Jeanne. Heinrich wurde demnach genau wie seine Mutter als Landadliger erzogen, und er wuchs in einer Familie mit anderen Söhnen auf, die als Erwachsene seine Gefolgsleute werden sollten. Als seine Mutter den Thron erbte, wurde er schon als Kleinkind als Kronprinz behandelt.
Die zwei Jahre zwischen Heinrichs Geburt 1553 und ihre Thronbesteigung 1555 verbrachte Jeanne wiederum in Nordfrankreich in der Nähe ihres Gatten. In dieser Zeit gebar sie einen dritten Jungen, der jedoch nicht lange lebte. Es muss hinzugefügt werden, dass Anton von Bourbon 1554 einen außerehelichen Sohn, Karl von Bourbon, mit einer Hofdame bekam. Jeanne hatte bereits mehrere Onkel, die illegitim waren, und sie scheint den kleinen Karl in ihrer Familie aufgenommen zu haben. Er wurde später Erzbischof von Rouen.
Erst als der Vater gestorben war, zog sie als Königin nach Pau und obwohl sie die Erbin war, ließ sich ihr Mann als König huldigen, was die Ständeversammlung eigentlich gar nicht wollte, dennoch ordneten sie sich dem Willen Jeannes unter.
Königin an der Seite von Anton von Bourbon (1555–1560)
Ihr Vater hatte Jeanne ein blühendes Land hinterlassen. Er hatte Industrien nach Béarn geholt, das Steuersystem effektiv gestaltet und für den religiösen Frieden gesorgt. Große Einkünfte entstanden auch durch seine Posten als Gouverneur und Admiral der französischen Krone in Guyenne. Anton von Bourbon bekam diese Posten nach seinem verstorbenen Schwiegervater, und später hat sein Sohn, Heinrich von Navarra, sie übernommen. Jeanne und Antoine standen als die größten Grundbesitzer Südwestfrankreichs finanziell sehr gut da.
1555 find Calvin seine missionarische Tätigkeit in Frankreich an. Reformierte gab es in Südwestfrankreich zu diesem Zeitpunkt längst, weil Margareta von Navarra sie mit Predigern unterstützt hatte und Gérard Roussel, einen Reformkatholiken, als Bischof in Orthez, eingesetzt hatte. Dieser Roussel war einmal Weggefährte Calvins gewesen, und dieser warf ihm vor, nicht konsequent genug zu sein, als er die Stelle als katholischer Bischof trotz seiner reformatorischen Sympathien annahm (CStA I,1).
Als Königin hatte Jeanne bei ihrer Krönung versprechen müssen, die katholische Religion zu verteidigen. Am selben Tag, nachdem sie diesen feierlichen Eid abgelegt hatte, schrieb sie an einen Vasallen, dem vicomte von Gourdon, und erzählte ihm, sie wolle über die Förderung des reformierten Glaubens im kleinem Kreis heimlich beraten. Dieser Brief ist Teil eines Briefwechsels mit zwei vicomtes de Gourdon, Vater und Sohn, die die gesamte Regierungszeit Jeannes überdauerte. Die Briefsammlung wurde im vorigen Jahrhundert entdeckt und gibt viele neue Einsichten in die Vorhaben und die Beweggründe Jeannes. Da die entdeckten Briefe uns nur als teilweise fehlerhafte Kopien vorliegen, haben viele Forscher die Briefe als Fälschungen abgetan (Text und Diskussion bei Bryson).
Der erste Brief vom August 1555 teilt uns mit, dass Jeanne schon zu diesem Zeitpunkt reformierte Sympathien deutlich aussprach. Sie schrieb dem vicomte, dass ihre Mutter sich zwischen den zwei Religionen nicht habe entscheiden können, und dass sie selbst aus Furcht vor ihrem Vater bislang nicht gewagt habe, sich offen zum Protestantismus zu bekennen. Das Edikt von Chateaubriant von 1551 verbot eindeutig jede „Ketzerei“ und deshalb schlug sie vor, die Reformierten sollten sich heimlich auf dem Schloss Odos treffen.
Es gibt sonst keine Quellen, die belegen könnten, dass Jeanne mit dem reformierten Glauben in Berührung kam. Es gab in ganz Frankreich zu der Zeit kleine zerstreute Gemeinden, sowie Prediger und Kolporteure, die reformatorische Bücher schmuggelten. Die wiederholten Verbote des Königs konnten das nicht unterbinden, sie führten nur dazu, dass Protestanten, wie Jeanne, sich heimlich treffen mussten.
In den Jahren nach 1555 verbreitete sich der reformierte Glaube mehr und mehr im Hochadel. Auch Anton von Bourbon wurde davon ergriffen, brachte reformierte Prediger nach Béarn und als er und Jeanne 1558 mit Heinrich nach Paris zogen, nahm er an großen psalmensingenden Demonstrationen außerhalb der Stadtmauern von Paris teil. Calvin war darüber hoch erfreut, denn er setzte in seiner Missionsarbeit gerne auf hochrangige Persönlichkeiten. Jeanne dagegen verhielt sich während dieser Zeit bedeckt.
In Paris kam sie mit ihrem vierten Kind, einer Tochter namens Katharina, nieder. Das kleine Mädchen war das einzige Kind, das bei Jeanne aufwachsen durfte, obwohl sie (natürlich) Erzieherinnen und Gouvernanten hatte.
Anton von Bourbon fiel nicht nur mit protestantischen Sympathien auf, sondern wie sein Schwiegervater versuchte er, den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. Heinrich d´Albret hatte seinen Besitz gut und gewinnbringend regiert, während Anton von Bourbon seiner Frau die Regierungsgeschäfte überließ, und selbst nur versuchte, ein größeres Königsreich für sich zu gewinnen. So konnte der spanische König Philipp ihm einen Tausch, erst mit dem Herzogtum Milano und später mit Sardinien, anbieten. Damit hätte Spanien den Sprung über die Pyrenäen geschafft und Südfrankreich bedrohen können. Wir würden solches Taktieren mit dem Feind Hochverrat nennen, damals räumte man freilich Adligen große Freiheiten ein, sich einen Herren auszusuchen, aber Anton von Bourbon wurde auch von den Zeitgenossen als unzuverlässig und unverantwortlich angesehen, und nicht zuletzt war er so politisch ungeschickt, dass es an Dummheit grenzte (Sutherland 1984).
Im Sommer 1559 starb Heinrich II. von Frankreich unerwartet. Sein Sohn Franz II. folgte ihm als nur fünfzehnjähriger Knabe auf dem Thron. In dieser Situation war die traditionelle Lösung, dass der erste erwachsene Erbprinz, Anton von Bourbon, ihn unterstützen sollte, und Calvin ermahnte ihn eindringlich, dieses Amt zu übernehmen und dabei den Hugenotten zu helfen. Anton von Bourbon verspielte diese Chance und überließ die Regierungsgeschäfte der Familie von Guise, besonders dem Herzog von Guise und dem Kardinal von Lorraine, die beide die antiketzerische Politik des verstorbenen Königs weiterführen wollten. Nach dem Tod Heinrichs II. bekannten sich mehrere hochrangige Adlige offen zum Protestantismus und es gab im März 1560 sogar einen hugenottischen Komplott, den König zu entführen und von seinen „schlechten Ratgebern“ zu trennen. Anton von Bourbon und sein jüngerer Bruder, der Prinz von Condé, beide notorische Reformierte, wurden wegen diesem Angriff auf den König angeklagt. Anton von Bourbon versprach Besserung, während sein Bruder, der Prinz Ludwig von Condé zum Tode verurteilt wurde. Nur der plötzliche Tod des jungen Königs rettete ihn vor der Hinrichtung. Da der neue König, Karl IX., ein zehnjähriges Kind war, brauchte Frankreich einen Regenten, nämlich den ranghöchsten Erbprinz Anton von Bourbon. Wiederum ergriff dieser nicht die Chance. Katharina von Medici ließ sich stattdessen als Regentin einsetzen und Anton von Bourbon wurde zum Generalstatthalter ernannt. Die Hugenotten mit Calvin an der Spitze waren zutiefst enttäuscht. In diesen Jahren hatte der reformierte Glaube großen Zulauf, es wurde von mehreren Tausend Gottesdienstbesuchern überall in Frankreich berichtet, von Abendmahlgottesdiensten, die zwei Tage dauerten und von Bekehrungen am Hof und im Hochadel.
1560 verließ Jeanne Paris, um zurück nach Pau zu fahren. Theodorus Beza, der engste Mitarbeiter Calvins, besuchte sie dort, und es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit, die bis Jeannes Tod dauerte. Beza versorgte sie mit Predigern und Beratern für ihr Land. Im Dezember 1560 unternahm Jeanne den entscheidenden Schritt und bekehrte sich öffentlich zum reformierten Glauben. Während ihr Gatte nicht in der Lage war, sich an die Spitze der Hugenotten zu setzen, wurde sie jetzt die leitende Hugenottin in Frankreich.
Reformierte Königin (1560–1568)
Jeanne d´Albret war zweifelsohne eine tief religiöse Frau. Lange Zeit hatte sie äußerste Diskretion walten lassen, zwar mit ihrem Gatten reformierte Prediger gehört, aber sich niemals offen zum reformierten Glauben bekannt. Erst nachdem Anton von Bourbon sich mit dem Posten als lieutenant générale abgefunden hatte, kam sie aus der Deckung.
Es war eine Zeit, wo alle große Hoffnungen bzw. Ängste für den Protestantismus in Frankreich hegten. Drei wichtige Katholiken – der Herzog von Guise, der Konstabel von Montmorency und der Marschall St. André – schlossen sich zusammen, um Frankreich gegen die Reformierten zu schützen. Sie planten den Sturz von Anton von Bourbon und einen Angriff auf Genf mit der Hilfe des Herzogs von Savoyen, zu dessen Besitz Genf bis 1534 gehört hatte. Dieses Triumvirat war der erste Vorbote der katholischen Liga, die später Heinrich IV. hartnäckig bekämpfte (Sutherland 1973).
1560 war noch zu erwarten, dass der Protestantismus nach Frankreich gekommen war, um zu bleiben. Jeanne war sich sehr bewusst, welche Gefahren ihr von Spanien, vom Papst und von der mächtigen Familie von Guise drohten. Sie hatte noch die Hoffnung, dass der junge König Karl IX., Katharina von Medici und ihr Kanzler, der tolerante Michel de l´Hôpital, die Reformierten unterstützen würden, zumal die Königinmutter sich selbst von denen von Guise bedrängt fühlte.
Diese letzte Hoffnung erwies sich als trügerisch, aber niemals wich Jeanne später vom einmal eingeschlagenen Kurs ab. Sie konnte weder geldwerte Vorteile noch politisches Kapital aus ihren Glauben schlagen, dafür hielt sie konsequent an ihrer Überzeugung fest.
In Béarn machte sie erste vorsichtige Schritte, um das Land zu reformieren. Es gab schon Reformierte dort, und Prediger hatten angefangen, den neuen Glauben zu verbreiten, Jeanne aber träumte von einem reformierten Land, und fing langsam und vorsichtig an, diesen Traum zu verwirklichen.
Der erste Schritt war, den reformierten Glauben dem Katholizismus rechtlich gleich zu stellen. Die Kirchen wurden für beide Religionen geöffnet (das sogenannte simultaneum) und aus den Kirchen in Lescar und Pau wurden Bilder und Statuen entfernt, allerdings nicht in Form eines Bildersturms, sondern von den Behörden. Jeanne beschlagnahmte das kirchliche Vermögen nicht für sich selbst, sondern investierte es in Sozialfürsorge und Bildung.
Es ist klar, dass sie den reformierten Glauben einführen wollte, aber zu keinem Zeitpunkt vefolgte sie Andersgläubige, geschweige denn verbrannte sie. Immer setzte sie auf Überredung.
Im August 1561 begab sie sich wieder zum Hof. Überall wurde sie stürmisch von Hugenotten begrüßt, als ob sie „der Messias sei“, bemerkte verärgert der spanische Gesandte. Katharina von Medici hatte zu einem Religionsgespräch eingeladen. Dieses Gespräch fand in Poissy außerhalb Paris statt. Seitens der Krone war gewiss an eine Versöhnung oder gar einen Ausgleich zwischen den Religionen gedacht, die reformierten Teilnehmer mit Beza an der Spitze mochten jedoch keine Kompromisse eingehen. Beza wurde unterstützt von Calvin in Genf, der selbst zu krank war, um mitzukommen. Calvin war mit den Auftritten und Reden Bezas zufrieden, während z.B. der Admiral Coligny Beza als reichlich provokant wahrnahm.
Im Herbst 1562 blieb Jeanne mit ihren Kindern beim Hofe. Katharina von Medici suchte auch nach den Religionsgesprächen eine Übereinkunft mit den Protestanten, was in dem Edikt vom 17. Januar 1562 – auch Edikt von St. Germain genannt – gipfelte. Dieses Edikt, an dem der Kanzler Michel de l´Hôpital und Beza beteiligt waren, erlaubte es den Hugenotten, außerhalb der Städte Gottesdienste zu halten. Es war das günstigste Edikt, das sie jemals erlangen sollten, das Edikt von Nantes 1598 war ihm sehr ähnlich, aber nicht ganz so großzügig. Der Unterschied war, dass Heinrich IV. dafür sorgte, dass das Edikt von Nantes durchgeführt wurde, während alle frühere Edikte, so wohlgemeint sie auf dem Papier auch waren, von katholischen Behörden unterlaufen wurden, und der König zu schwach war, um für ihre Durchführung zu sorgen.
Im März 1562 massakrierte der Herzog von Guise eine reformierte Gemeinde, die innerhalb des Städtchens Wassy Gottesdienst feierte. Damit war die Versöhnungspolitik Katharinas von Medici gescheitert. Die Hugenotten unter dem Prinzen von Condé griffen zu den Waffen und Anton von Bourbon bat Jeanne den Hof zu verlassen. Er behielt seinen Sohn Heinrich bei sich, entließ aber dessen hugenottischen Hauslehrer. Jeanne beschwor ihren Sohn, nicht zur Messe zu gehen, und der junge Prinz hielt sich wohl auch ein paar Wochen daran, musste sich aber schließlich fügen. Nach ihrem Fortgang vom Hofe trat Jeanne eine monatelange abenteuerliche Reise durch Frankreich an, so gefährlich, dass die ersten Briefen von der Hand Heinrichs seine Ängste um seine Mutter bezeugen. Ihre kleine Tochter Katharina durfte sie behalten.
Im ersten Religionskrieg führte Anton von Bourbon die königlichen katholischen Truppen gegen die Hugenotten. Bei der Belagerung von Rouen wurde er verwundet und starb am 17. November. Der junge Heinrich blieb am Hofe in der Obhut Katharinas von Medici, die allerdings Jeanne gestattete, ihm wieder reformierte Hauslehrer zu geben. Sie sollte ihn erst 1564 wiedersehen.
Die Kirche in Béarn und Navarra
Ihre große Aufgabe sah Jeanne darin, die Reformation in Béarn durchzuführen.
Calvin stellte ihr Jean Raymond Merlin zur Seite, den früheren Professor für Hebräisch in Lausanne, wo er Kollege von Beza, dem Professor für Griechisch, und von Pierre Viret, dem Rektor der Akademie, gewesen war. Pierre Viret arbeitete nach seiner Zeit in Lausanne und Genf vor allem in Frankreich, besonders in den Kirchen von Lyons und Nîmes. Später sollte er für Jeanne d´Albret ihre Akademie in Orthez aufbauen. Merlin war übrigens mit einer Tochter von Marie Dentière verheiratet, derjenigen, die vor Jahren Jeanne eine selbstgeschriebene hebräische Grammatik zugesandt hatte (vgl. Graesslé13f.; Nielsen).
Merlin ging voll Eifer an die Aufgabe, eine reformierte Kirche in Béarn aufzubauen. Es gab viele Reformierte in Südfrankreich, aber meistens unter städtischen Eliten und Handwerkern. Die Reformierten waren meistens des Lesens fähig, vor allem des Lesen französischer Texte. In Südwestfrankreich sprach die Bevölkerung die langue d´oc, die alte oczitanische Sprache, in irgendeiner Form. Die Gascogne hatte ihre Sprache, in der ein Neues Testament und fünfzig Psalmen übersetzt wurden, und Béarn hatte béarnais sogar als Amtssprache. Hinzu kam, dass die Bevölkerung in Navarra Baskisch sprach. Wenn Merlin das ganze Land reformieren sollte, musste er diese Sprachbarrieren überwinden, denn die Landbevölkerung musste erreicht und für die Reformation gewonnen werden.
Jeanne d´Albret beauftragte eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Baskische, und eine Übertragung der Psalmen, der Zehn Gebote, der Liturgie und des Katechismus Calvins in die Sprache Béarns. Der Anwalt, später Pastor, Arnaud de la Salette, stellte 1571 diese Übersetzung fertig, und obwohl sie erst 1583 gedruckt wurde, darf man annehmen, dass in der Zwischenzeit Manuskriptkopien verwendet wurden. Pastoren, die die béarnesische oder die baskische Sprache beherrschten, wurde händeringend gesucht, und von den Anderen wurde ausdrücklich verlangt, dass sie es lernen sollten. Katecheten, die vermutlich Landeskinder waren, wurden in die Gemeinden geschickt.
Allmählich verbot Jeanne katholische Riten und Gebräuche, zuerst die Fronleichnamsprozessionen, danach Maibäume und Jahrmärkte. Dann wurde die Messe abgeschafft. Der Dom von Lescar und die Kirche St. Martin in Pau wurden leergeräumt, und die dort befindlichen Schätze verkauft.
Für Merlin konnte dies nicht schnell genug gehen. In seinen Briefen an Calvin klagte er seine Not: die Bevölkerung sei stur – diese Holzköpfe! - und die Königin zu langsam und vorsichtig (CO 20, Nr. 3988 & Nr. 4061). Merlin hatte übrigens auch früher in Montargis Probleme mit Renée de France gehabt, Herzogin von Ferrara, die in ihrem Gebiet so vorsichtig war wie Jeanne in Béarn (vgl. Lambin, 2). Jeanne bekam Klagen auf der jährlichen Ständeversammlung, wo die Katholiken über den Verlust alter Freiheiten und Rechte klagten. In den sechziger Jahren musste sie mehrmals Aufstände niederschlagen.
Der Nachfolger für Merlin war Pierre Viret, der enge Freund Calvins. Er war Pastor und Rektor für die Akademie in Lausanne – mit Beza und Merlin als Kollegen – gewesen. Wegen eines Streits mit dem Stadtrat in Bern, übersiedelten 1559 alle Professoren nach Genf, um dort in der neu errichteten Akademie zu unterrichten. Von Genf begab Viret sich nach Frankreich, wo er in Lyon als Pastor arbeitete, danach leitete er die Nationalsynode in Nîmes und schließlich folgte er dem Ruf nach Béarn. Seine wesentlichste Aufgabe war es, die Akademie in Orthez aufzubauen. Die Fächer Theologie, Hebräisch, Griechisch, Philosophie und Mathematik wurden dort unterrichtet, während es keine Anzeigen für Professuren in Jura und Medizin gibt.
Vor ihrer akademischen Laufbahn absolvierten die Jungen eine fünfjährigen Ausbildung in einer Lateinschule (collège), während die Grundschule sowohl Jungen wie Mädchen unterrichtete, die Mädchen allerdings getrennt mit weiblichen Lehrkräften. Damit wurde das kleine Béarn das erste Land Europas, welches kostenlosen Unterricht für Mädchen zusicherte, und zwar mit der interessanten Begründung, dass sie so im Stande waren, ihr Brot zu verdienen und sich der Gesellschaft nützlich zu machen („Pareil rolle sera aussy faict des filles qui sont en bas aage et qui n´ont nul moyen de vivre et de s´entretenir, par toutes les églises, afin que de mesmes deniers et en écolle séparée elles soient enseignées, nourries et tenues par des femmes sages et pudiques, par leur industrie pouvoir aprés se nourrir et entretenir et servir au public“. Art. 32 der Verfassung der Akademie von 1566, zitiert nach Desplat 2004). Desplat unterstreicht die säkulare Ausrichtung der Ausbildung. Allgemein wird behauptet, der Zweck des Unterrichts in protestantischen Ländern sei, die Bevölkerung des Lesens der Bibel und des Katechismus zu befähigen. Hier werden nur die Vorteile eines Schulunterrichts für die Gesellschaft betont.
Die Akademie wurde 1566 geöffnet. Die ersten protestantischen Akademiegründungen in Frankreich fanden in Nîmes (1562) und Montpellier statt. Vorrangiges Ziel war es, die Kirchen mit Pastoren zu versorgen, da die Akademie in Genf die steigende Nachfrage der Gemeinden kaum nachkommen konnte. Da Papst Pius V. die katholischen Universitäten angewiesen hatte, Protestanten die Abschlüsse zu verweigern (Maag 2002, 140), brauchten junge Hugenotten ihre eigenen Universitäten, die dann auch gegründet wurden, vor allem in Leiden und Heidelberg, aber auch in Frankreich und benachbarten Gebieten wie Béarn, Orange und Sedan, die alle zu diesem Zeitpunkt unabhängig waren.
Jeanne hatte sehr gute Gründe, langsam und überlegt vorzugehen. Der Kardinal von Armagnac ließ sie wissen, dass sie die Bevölkerung Béarns in Ruhe lassen sollte, ihre Untertanen wollten ihren Katholizismus nicht aufgeben. Jeanne antwortete, dass sie in Béarn nur Gott über sich habe, dort könne sie ihrem Gewissen folgen, und in ihrem Land werde niemand wegen seines Glaubens verfolgt. Das letzte war ihr ein Anliegen, denn 1571 schrieb sie an ihren Statthalter, den Baron d´Arros, dass in ihrem Land niemand zum Glauben je gezwungen worden war und es auch nicht werden sollte („...intention n´a point esté et n´est encores qu´ilz soyent contraints par force et violence de se reanger à ladite Religion“, d´Aas 2002, 452).
Als sie sich bei der Einführung der Reformation in ihren Ländern unnachgiebig zeigte, zitierte der Papst sie nach Rom zwecks eines Ketzerprozesses. Da sie dieser Einladung nicht folgte, exkommunizierte er sie. Der Bann war eine ernste Bedrohung, da jeder katholische Herrscher jetzt das Recht hatte, ihre Länder an sich zu reißen und sie abzusetzen, eine Chance, die Philipp II. von Spanien sich nicht entgehen lassen würde. Katharina von Medici verteidigte deshalb Jeanne, weil sie keine spanische Präsenz auf der französischen Seite der Pyrenäen dulden wollte. Außerdem war sie eine Verfechterin der gallikanischen Freiheit der französischen Kirche und meinte deshalb, der Papst solle sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einmischen.
Königin der Hugenotten
Nach dem ersten Religionskrieg (1562-63) ließ Katharina von Medici den jungen Karl IX. mündig erklären und führte ihn mit dem Hof auf eine große Frankreichreise, die mehrere Jahre dauerte. Der Zweck dieser Reise war es, den König dem Volk zu zeigen, und damit die Loyalität der Bevölkerung zu erhalten. Jeanne wurde als Vasallin einberufen und stieß Ende Mai 1564 zum Zug in Macon.
Ihr Sohn Heinrich nahm auch Teil an diese Reise und seinetwegen stritten die zwei Königinnen sich, weil Jeanne ihn bei ihren protestantischen Gottesdiensten dabei haben wollte, und Katharina wünschte, dass er mit der königlichen Familie zur Messe gehe. Schließlich sandte Karl IX. Jeanne zu ihrem Besitz in Vendôme, während Heinrich als Gouverneur von Guyenne den Zug begleitete und in den Städten für den feierlichen Empfang des Königs sorgte.
Jeanne durfte nicht mit nach Bayonne, wo Katharina ihrer Tochter Elizabeth, Königin von Spanien, begegnen wollte. Philipp II. sandte als seinen Gesandten den Herzog von Alba, der auf dem Weg in die Niederlande war. Die Hugenotten waren später überzeugt, dass Alba und die Königinmutter in Bayonne ihre Ausrottung geplant hatten. Sicher ist, dass Alba in den Niederlanden mit aller Härte gegen die Protestanten vorging, und es ist durchaus möglich, dass er versuchte, Katharina auf seinen mörderischen Kurs einzustimmen. Schon 1568 – also vor der Bartholomäusnacht! – schrieb Jeanne, dass die Waffen, die gegen die Hugenotten verwendet werden sollten, in Bayonne geschmiedet worden seien (Ample déclaration).
Jeanne und Heinrich trafen sich später in Paris. 1566 ersuchte sie erneut um Erlaubnis, mit ihren beiden Kindern nach Béarn zu fahren, was ausgeschlagen wurde. Sie erhielt aber Erlaubnis, ihren Sohn in seinen französischen Ländereien herumzuführen, und Anfang 1567 reiste sie dann mit ihm nach Vendôme, und von dort setzte sie sich unerlaubt ab nach Béarn. Damit machte sie laut des Biographen Heinrichs, Pierre Babelon, aus einem französischen Prinzen einen Ausländer, und vor allem einen Hugenotten.
Von 1567 an arbeitete Jeanne für die Zukunft ihres Sohnes. Ihre Lebensaufgabe, schrieb sie selbst, sei: Gott, Königtum und ihr Blut. Mit Gott war die reformierte Religion, die wahre Kirche Gottes, gemeint. Mit dem König ihr Status als Vasallin und – trotz Béarn – als Französin, und mit dem „Blut“, die Familie, zuallererst ihr Sohn Heinrich. Er sollte von jetzt an kein Höfling mehr sein, sondern die Aufgaben eines Regenten lernen. Als ein Aufstand in Navarra niedergeschlagen worden war, wurde er dorthin geschickt, um die Basken zu befrieden. Als 14jähriger hielt er für seine Untertanen eine Rede, in welcher er ihr Fehlverhalten geißelte, ihnen die Gunst der Königin zusicherte, falls sie sich verbessern würden, und seinen berühmten Charme mit seinem Autoritätsanspruch verband.
Im Herbst 1567 versuchten die Hugenotten, die sich von der Aufrüstung des Königs bedroht fühlten, Karl IX. in ihre Gewalt zu bringen. Die Entführung missglückte, und die königliche Familie suchte, beschützt von den schweizerischen Söldnern, die die Ängste der Hugenotten verursacht hatten, Zuflucht in Paris. Die Hugenotten belagerten die Stadt. Im November wurden sie vor den Toren von St. Denis geschlagen und mussten sich in die Provinz zurückziehen, wo sie den Kampf bis zum Friedenschluss von Longjumeau im März 1568 fortsetzen.
Der Friedensvertrag war an sich nicht ungünstig für die Hugenotten, nur haperte es wie immer mit der Umsetzung. Katholische Behörden waren über die für die Hugenotten günstigen Bedingungen empört und setzten sie nicht um. Der Protestant La Noue schrieb in seinen Erinnerungen, dass der Krieg zwar viel Unheil bringe, aber dieser elende kleine Friedensvertrag sei viel schlimmer für die Reformierten, die in ihren Häuser umgebracht wurden, ohne dass sie sich zu wehren wagten („ …une guerre est misérable et qu´elle apporte avec soy beaucoup des maux…cette méchante petite paix est beaucoup pire pour ceux de la Réligion, qu´on assassinoit en leur maisons, et ne s´osoyent encores défendre“, d´Aas 2002, 382) Im Laufe des Sommers 1568 versuchten die Gruppierungen noch einmal miteinander zu reden, Karl IX. sandte einen Botschafter nach Béarn, und Jeanne verfasste ein Sendschreiben an den König mit dem Antrag, den Frieden in Guyenne wiederherzustellen.
In der Zwischenzeit fühlten sich der Prinz von Condé und der Admiral Coligny auf ihre Schlösser in Bourgogne zunehmend bedroht. Der Herzog von Alba wollte in den Niederlanden mit Feuer und Schwert den Protestantismus auszurotten, und Flüchtlinge berichteten ihnen von seinem Terror. Am 23. August 1568 flüchteten sie mit ihren Familien und Angehörigen über die Loire nach La Rochelle. Die Überquerung der Loire erinnerte fast an den biblischen Durchzug durchs Schilfmeer: so viele Hugenotten hatten sich angeschlossen, dass der Zug fast wie eine Völkerwanderung aussah, und die Loire hatte in der Augusthitze einen so niedrigen Wasserstand, dass Sandbanken in der Mitte auftauchten. Dementsprechend sangen alle Psalm 114 vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, als sie hinüber waren. Die Parallele wurde noch einmal deutlich, als die königlichen Truppen, die sie verfolgten, wegen plötzlich einsetzenden Hochwassers den Fluss nicht überqueren konnten.
In dieser Situation war Jeanne zutiefst gespalten. Bislang hatte sie die Kriege moralisch unterstützt, aber nicht selbst teilgenommen. Falls es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte, konnte sie immer mit ihren Kindern in der uneinnehmbaren Festung Navarrenx Zuflucht suchen. Sie hatte jedoch ihren Sohn, der als zukünftiger Führer der Hugenotten das Kriegshandwerk lernen sollte, und so musste sie wählen, ob sie in Béarn unter ihrem Volk bleiben oder sich den Hugenotten anschließen sollte: „ich hatte den Krieg im Bauch“ schrieb sie danach („J´eu la guerre en mes entrailles“, Ample declaration). Sie setzte den Baron d´Arros als Statthalter ein, und Anfang September begab sie sich in Eilmarsch nach La Rochelle (Cocula 2004). Dort konnte sie ihren Sohn dem Prinzen von Condé überantworten. Sie schrieb unterwegs eine Reihe Briefe an Karl IX., an Katharina von Medici, an ihren Schwager, den Kardinal von Bourbon und an die Königin Elizabeth von England, um ihren Entschluss zu begründen. Angekommen in La Rochelle schrieb sie eine Erklärung („Ample declaration“) um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie sich der hugenottischen Armee zugesellte.
Die Hugenotten unter ihren Anführer aus der königlichen Familie wollten nicht als Aufrührer dastehen. Sie behaupteten, die erzkatholische Partei sei schuld daran, dass königliche Befehle nicht vollzogen wurden. Die Katholiken mit ihren Verbindungen nach Spanien und Rom seien Landesverräter. Die Politik des Kardinals von Lorraine verdient laut Sutherland (1974) keinen anderer Namen. Wenn Jeanne vom Frieden sprach, meinte sie eine Duldung der Hugenotten in Frankreich. Die Forderungen der Hugenotten waren immer dieselbe: Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, Gerichte mit zur Hälfte hugenottischen Richtern, sichere Zufluchtsstädte – deren Anzahl schwankte in den Verhandlungen – und Zugang zu Ausbildung und Beamtenstellen gleichrangig mit den Katholiken. Die Provinz Languedoc unter dem moderat katholischen Gouverneur Montmorency-Damville war ein friedlicher Ort in den Religionskriegen, weil Damville den Hugenotten solche Rechte einräumte, und die katholische Bevölkerung sich damit abfand.
Im März 1569 fand eine Schlacht bei Jarnac statt. Der Prinz von Condé kämpfte mit, wurde verwundet und nach der Schlacht ermordet. Es gelang Admiral Coligny, die hugenottischen Truppen zusammenzuhalten, aber der Verlust des Prinzen war ein herber Schlag. Heinrich von Navarra war jetzt der ranghöchste Prinz, und zusammen mit seinem Vetter, dem gleichaltrigen Heinrich von Condé, wurde er jetzt Oberbefehlshaber über die Armee der Prinzen. In Wirklichkeit lag die Verantwortung für die Kriegsführung bei dem erfahrenen Admiral, und die beiden Prinzen wurden seine Pagen genannt.
Jeanne blieb in La Rochelle, während Coligny mit den Prinzen im Krieg war, und sie konnte, unterstützt von einem Rat adliger Hugenotten, die „Regierungsgeschäfte“ regeln. Sie schrieb an England und nach Deutschland. Sie unterzeichnete Erlässe, versuchte Geld für das Heer aufzutreiben, pfändete ihren schönsten Schmuck für einen Kriegsdarlehen an Elizabeth von England und ließ ein Kriegsschiff namens „Die Hugenottin“ bauen.
So wie sie immer behauptete, nicht gegen den König, sondern gegen seine schlechten Ratgeber zu kämpfen, so behauptete Karl IX., dass sie in La Rochelle von den Hugenotten gefangen gehalten wurde, und er ließ den Baron Terride mit einer „Befreiungsarmee“ in Béarn einfallen. In kürzester Zeit waren ganz Béarn und Navarra erobert und zum Katholizismus zurückgeführt. Nur der Baron d`Arros hielt im Navarrenx stand. Um ihre Länder zurückzuerobern, sandte Jeanne den Graf von Montgommery mit einer „Hilfsarmee“ nach Navarrenx. In noch kürzerer Zeit als Terride gebraucht hatte, verjagte er ihn aus Béarn. Die Befreiung von Terride wurde in Pau mit einem Festgottesdienst gefeiert, wobei Pierre Viret über Psalm 124, 7: „Unsere Seele ist aus dem Netz des Vogelfängers entkommen“ predigte.
Vom Winter 1569 bis zum Frühjahr 1570 führte Coligny sein Heer mit den Prinzen Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé durch ganz Südfrankreich und von Provence nach Norden, bis er Paris bedrohte. Der König hatte kein Geld mehr, um Krieg zu führen, und musste notgedrungen Friedensverhandlungen einleiten. Im August 1570 wurde dann der Frieden von St. Germain geschlossen. Wiederum war Jeanne d´Albret diejenige, die auf Augenhöhe mit dem König verhandeln konnte. Der Vertragstext erklärt immer wieder, dass der König die Bedingungen seiner Tante erfüllen wollte (Sutherland 1980, Potter 1997).
Jeanne blieb vorläufig in La Rochelle. Im April 1571 fand dort die Nationalsynode der reformierten Kirchen Frankreichs statt. Theodor Beza kam aus Genf angereist, um die Synode zu leiten. Pierre Viret wollte teilnehmen, starb aber vorher, vermutlich hatte seine Gesundheit in der Gefangenschaft unter Baron Terride gelitten. Auf der Synode wurde das französische Glaubensbekenntnis von 1559 neu verhandelt und die endgültige Fassung als „Bekenntnis von La Rochelle“ beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Kirchenordnung für Béarn beschlossen, und die Synode diskutierte Fragen, die Jeanne d´Albret gestellt hatte. Als Ersatz für Pierre Viret bekam sie Nicolas des Gallars zur Seite gestellt. Er war Calvins Sekretär gewesen, danach hatte er die „Strangers´ Church“, die Kirche für Ausländer in London, als Nachfolger für Johannes à Lasco geleitet und dann an Bezas Seite im Colloquium von Poissy 1561 gestanden. Er war Pastor in Orléans gewesen und wurde jetzt Seelsorger für Jeanne d´Albret und ihr theologischer Ratgeber für die Kirche in ihrem Land.
Er war eine gute Wahl, denn während Beza sehr an dem Konzept von Genf hing und ein presbyteriales Kirchenverständnis (Kingdon 1967) hatte, war des Gallars in England gewesen, als Königin Elizabeth nach dem Tod ihrer katholischen Schwester die anglikanische Kirche einführte. Außerdem behauptet Bernard Roussel (2004), dass er das Buch Martin Bucers „De regno Christi“ von 1550 mitbrachte. Dieses Buch ist dem englischen König Edward VI. gewidmet und beschreibt, wie ein König eine reformierte Kirche leiten kann. Damit hatte des Gallars ein Konzept für eine von einer Fürstin geleitete Kirche, die dann in den Jahren als Heinrich und Katharina von Navarra das Erbe der Mutter verwalteten, Bestand hatte.
Während Jeanne in La Rochelle noch weilte, ereilte sie ein Angebot von Katharina von Medici, ob ihren Sohn Heinrich die Tochter Katharinas heiraten mochte. Hugenotten und Katholiken würden sich versöhnen und die Häuser Valois und Bourbon sich nahekommen. Dieses Angebot war zu verlockend, um es auszuschlagen, aber Jeanne traute Katharina nicht so recht, jedenfalls wollte sie nicht gleich nach Paris ziehen, um über die Ehe zu verhandeln.
Stattdessen fuhr sie nach Pau zurück, führte die neu beschlossene Kirchenordnung ein und kümmerte sich um ihre Länder. Die Tuberkulose machte sich bemerkbar und sie wollte zur Kur in die Bergen fahren. Währenddessen zogen sich die Eheverhandlungen hin, bis Jeanne endlich im Frühjahr 1572 nach Paris zog. In den Briefen an ihren Sohn hört man von den Verhandlungen, von ihrer Missbilligung des höfischen Lebens und von ihrem Ärger mit Katharina. Jeanne wollte so viele Rechte wie möglich für ihren Sohn und die Hugenotten aushandeln. Am Ende musste sie es aufgeben, Margareta von Valois, Margot genannt, zum reformierten Glauben zu bekehren. Dafür hoffte sie aber, dass das Brautpaar nach Béarn ziehen würde. Eine königliche Mischehe war etwas ganz Neues und musste in Detail besprochen und geplant werden. Jeanne handelte das Meistmögliche für ihren Sohn aus und im April 1572 wurde eine Einigung erzielt. Heinrich sollte allerdings noch eine Weile in Béarn bleiben und Jeanne bereitete in Paris die Hochzeit vor.
Die zähen Verhandlungen im Frühjahr hatten viel Kraft gekostet, Jeanne hielt sich aber tapfer. Im Juni brach sie zusammen und starb am 9. Juni an der Tuberkulose, die sie seit Jahren geplagt hatte. Später entstanden Gerüchte, sie sei von Katharina von Medici vergiftet worden. Diese sollte ihr ein Paar Handschuhe, die von ihrem privaten Giftmischer präpariert worden seien, geschenkt haben. Da Katharina nach den Massakern von St. Bartholomäus, die in der Periode von August bis November 1572 stattfanden, von den Hugenotten als der Inbegriff des Bösen dargestellt wurde, gehört der Giftmord an Jeanne d´Albret zu den Verleumdungen.
Heinrich traf erst etwas später in Paris ein. Im Testament Jeannes hatte sie sich gewünscht, in Béarn bei ihrem Vater beerdigt zu werden. Ihr Sohn setzte sich über ihren letzten Willen hinweg: sie wurde nach Vendôme geführt und neben ihrem Mann, Anton von Bourbon, bestattet.
Trotz ihre Fähigkeiten wurde sie eine Fußnote in der Geschichte Frankreichs: ihr Sohn wurde zwar als Heinrich IV. König von Frankreich, aber er wurde katholisch und aus den Hugenotten wurde, dank des Ediktes von Nantes 1598, eine geduldete Minderheit. Die Kirche, die Jeanne in Béarn aufgebaut hatte, wurde unter ihrem Enkelsohn, Ludwig XIII., verboten. 1685 wurde dann das Edikt von Nantes aufgehoben, und die Reformierten wurden grausam verfolgt. Viele flüchteten, viele konvertierten und viele wurden umgebracht. Die großen Hoffnungen, die die Hugenotten um Jahr 1560, als Jeanne konvertierte, hegten, erwiesen sich als trügerisch.
Wenn auch letztlich nicht erfolgreich, war sie dennoch bewundernswert. Mit dem Admiral Coligny zusammen hatte sie den Frieden von St. Germain errungen, dann eine Landeskirche aufgebaut und ihre Kinder gefördert. Sie war die reformierte Präsenz in der königlichen Familie und in ihren letzten Jahren wurde sie die Königin der Hugenotten.
Stammtafeln der Familie von Valois und der Familie von Bourbon (PDF)
Literatur
Quellen:
Albret, Jeanne d´: Lettres suivies d´une ample Déclaration, ed. Bernard Berdou d´Aas, Biarritz 2007.
Bordenave, Nicolas de: Histoire du Béarn et de la Navarre, Paris 1873.
Bucer, Martin: De regno Christi: libri duo, 1550, ed. François Wendel, in: Robert Stupperich, Hrsg. Ser. 2, Opera latina Bd. 15,1, Gütersloh 1955. In: Studies in Medieval and Reformation Thought, Leiden 1982. „Du royaume de Jesus Christ“, édition critique de la traduction française de 1558/texte établi par François Wendel, Bd.15,2, Gütersloh 1954.
Calvin, Johannes: Calvini opera quae supersunt omnia (= CO), hrsg.v.W.Baum, E.Kunitz, E.Reuss, 59 Bde, Braunschweig/Berlin 1863-1900.
Calvin-Studienausgabe (= CStA), hrsg.v. E.Busch u.a., Neukirchen-Vluyn ab 1994.
Coudy, Julien, ed.: Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten, Darmstadt 1965
Potter, David, ed.: The French Wars of religion, Selected Documents, London & New York 1997.
Ruble, Alphonse de: Le mariage de Jeanne d´Albret, Paris 1877.
Ruble, Alphonse de: Antoine de Bourbon et Jeanne d´Albret, Paris 1881, 1882, 1885 & 1886, 4 Bde.
Ruble, Alphonse de: Jeanne d´Albret et la guerre civile, Paris 1897.
Ruble, Alphonse de: Mémoires et poésies de Jeanne d´Albret, Paris 1893, Slatkine Reprints Genf 1970 (online auf Französisch: https://archive.org/details/mmoiresetposies00rublgoog).
Stegman, A.: Les édits des guerres de religion, Paris 1979.
Sekundärliteratur:
Aas, Bernard Berdou d´: Jeanne III d´Albret, Chronique 1528-1572, Anglet 2002.
Actes du colloque “Arnaud de Salette et son temps – Le Béarn sous Jeanne d´Albret”, Orthez 1984 (war mir leider nicht zugänglich).
Actes du colloque “L ´Amiral de Coligny et son Temps”, Paris 1974.
Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Babelon, Pierre: Henri IV, Paris 1982.
Benedict, Philip, ed.: Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam 1999.
Benedict, Philip: “Confessionalization in France? Critical reflections and new evidence”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Bryson, David: Queen Jeanne and the Promised Land, Dynasty, Homeland, Religion and Violence in Sixteenth Century France, Leiden 1999.
Buisseret, David: Henry IV, London 1984.
Cazaux, Yves: Jeanne d´Albret, Paris 1973.
Cholakian, Patricia F. & Cholakian, Rouben C.: Marguerite of Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006.
Cocula, Anne-Marie: ”Été 1568. Jeanne d´Albret et ses deux enfants sur le chemin de La Rochelle”, Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Desplat, Christian: “Jeanne d´Albret, un modèle d´éducation maternelle?”, in: Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Eurich, Amanda: “Le pays de Canaan”: L´évolution du pastorat béarnais sous Jeanne d´Albret”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Graeslé, Isabelle: Vie et légendes de Marie Dentière, Bulletin du centre protestant d´études, Genéve 2003.
Greengrass, Mark: “The Calvinist experiment in Béarn”, in: A. Pettegree, A. Duke & G. Lewis: Calvinism in Europe 1540 - 1620, Cambridge 1994.
Kingdon, Robert M.: Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572, Genève 1967.
Knecht, R.J.: Catherine de´ Medicis, London 1998.
Kuperty-Tsur, Nadine: “Jeanne d´Albret ou la persuasion par la passion”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Lambin, Rosine: Calvin und die adelige Frauen im französischen Protestantismus, http://www.reformiert-info.de/2304-0-0-20.html
Maag, Karin: “The Huguenot academies: preparing for an uncertain future”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Martin-Ulrich, Claudie: “Récit de vie, récit de mort: Le Brief discours sur la mort de la royne de Navarre, Jeanne d´Albret” in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Mentzer, Raymond A. & Spicer, Andrew, eds.: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Nielsen, Merete: Theologie als Erzählung – erzählte Theologie, Das Heptameron von Margarete von Navarra, http://www.reformiert-info.de/side.php?news_id=5444&part_id=0&navi=4
Nielsen, Merete: Marie Dentière,
O große Not, Gott selbst ist tot
Vorläufige Anmerkungen zum Verständnis des Kreuzestodes Jesu

Vormerkungen
Das Kreuz mit dem Kreuz. Ist das Kreuz Jesu die Mitte der christlichen Glaubens (1.Kor.1,18) oder ist es das Ärgernis, das den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen den christlichen Glauben fremd oder sogar abstoßend macht? „Ich habe es nicht nötig, dass jemand für mich stirbt. Ich passe auf mich allein auf, und ich sorge auch dafür, dass es mir gut geht!“ – so höre ich Menschen sagen, auch solche, die sich in der Kirche zuhause fühlen.
Der ehemalige Bonner Superintendent Burkard Müller sagte in einer Rundfunkandacht am 10. Februar 2009: „Wenn in zwei Wochen die Passionszeit Christi beginnt und wir in der Kirche über Jesu Leidensweg nachdenken, wird sicherlich hier und da wiederholt werden: Jesus starb, um uns die Sünden zu vergeben. Bei mir würden Sie das allerdings nicht hören. Denn ich glaube das nicht. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, aber ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist.“[1] – Andere widersprachen heftig: Reißt hier nicht jemand den Grund der Kirche ein, wenn er die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu derart marginalisiert?
Und dann schlagen der christlichen Kreuzestheologie auch von Außerhalb die Wellen entgegen. Die Christenheit hat aus dem Kreuz ein Herrschaftsinstrument gemacht. Seit Konstantin der Große es auf seine Schilde und Feldzeichen malen ließ, haftet dem Kreuz etwas Imperatorisches an: Christianisierung der Sachsen – die Kreuzzüge gegen Juden, Moslems und selbst gegen die eigenen häretischen Geschwister in Konstantinopel. Tief beeindruckend ist die Szene aus dem Roman „Der letzte der Gerechten“ von Andre Schwarz Bart, in der der junge Jude Erni seiner Freundin Golda im besetzten Paris 1942 die Christen erklärt:
„O Erni“, sagte Golda, „du kennst sie doch, sag mir, warum sind die Christen so böse auf uns? Dabei sehen sie so nett aus, wenn man sie ohne Stern anschaut.“
Ernst schlang Erni seinen Arm um Goldas Schultern.
„Das ist sehr geheimnisvoll“, murmelte er auf jiddisch, „sie wissen es selbst nicht so genau. Ich bin in ihren Kirchen gewesen und habe ihre Evangelien gelesen. Weißt du, wer Christus war? Ein gewöhnlicher Jude wie dein Vater, eine Art Chassid.“
Golda lächelte sanft. „Du machst dich lustig“, sagte sie.
„Doch, doch, glaub mir, und ich wette sogar ,dass sie sich alle beide gut verstanden hätten, denn er war wirklich ein guter Jude, weißt du, eine Art vom Baal Schem Tow: ein Barmherziger, ein Sanfter. Die Christen sagen, dass sie ihn lieben, aber ich glaube, sie hassen ihn, ohne es zu wissen. Und deshalb nehmen sie das Kreuz am andern Ende und machen ein Schwert daraus und schlagen uns damit! Verstehst du, Golda“, rief er plötzlich seltsam erregt, „sie nehmen das Kreuz und drehen und drehen es um, mein Gott...“[2]
Eine andere Möglichkeit, mit dem Kreuz umzugehen, ist es, das Kreuz umzudeuten, es seiner furchtbaren Historizität zu berauben und zum Symbol zu erklären. Es wird dann zum Symbol, das Himmel und Erde verbindet, ein weltumspannendes Zeichen, das alle vier Windrichtungen bezeichnet. „Das Kreuz selbst symbolisiert die Vereinigung der Gegensätze, die Überwindung der dualen Weltsicht, die seit der Vertreibung aus dem Paradies das Schicksal des biblischen Menschen war.
Die horizontale Linie des Kreuzes steht für das Weibliche, die Erde, die Materie, die vertikale deutet auf die schöpferische Kraft des Männlichen, den Himmel und den Geist. Die Gegensätze können auch gefasst werden als Einheit von Zeit, als waagerechter Linie, und Ewigkeit als senkrechter Linie, wobei die Ewigkeit die Zeit in jedem beliebigen Punkt schneidet. Der Schnittpunkt der beiden Linien, in dem sie Eins werden, ist zugleich der Kraftpunkt, aus dem sich die ganze Welt entfaltet in die vier Himmelsrichtungen.“ [3] So wird das Kreuz Jesu entschärft, ent-geschichtlicht und auf eine Ebene allgemeingültiger Bedeutung gehoben und damit seiner furchtbaren konkreten Geschichtlichkeit beraubt. Aber die Frage ist erlaubt: Wer das Kreuz ins Symbolische verlagert, drängt der nicht auch Gott aus der Welt?
Die Probleme mit dem Kreuz sind nicht neu. Die vermutlich älteste Kreuzesdarstellung der Geschichte ist eine Karikatur auf der Wand einer Kaserne auf dem Palatin in Rom. Sie stammt aus dem 1. oder 2. nachchristlichen Jahrhundert. Die Karikatur verspottet einen offensichtlich christlichen Soldaten ob seines Gekreuzigten Gottes: Am Kreuz hängt ein Esel. Und Alexamenos betet diesen Eselsgott an. Was muß Alexamenos selber für ein Esel sein!? Kein Wunder, dass die Christenheit bis zur Konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert selbst auf alle Kreuzesdarstellungen verzichtet. In den Katakomben Roms sieht man den predigenden und den heilenden Jesus, aber nicht den Gekreuzigten. Das hat seinen Sinn.
1. I ad crucem – mors turpissima crucis
In der antiken Welt ist das Kreuz eine durch und durch unappetitliche Angelegenheit. Vom Kreuz redet man nicht – jedenfalls nicht in den Kreisen der gebildeten und anständigen Bürger Roms. Wenn die sittenlosen Soldaten einander verfluchen, dann sagen sie „I ad crucem“ – geh zum Kreuz, gemeint ist: geh zum Henker, oder geh zum Teufel! Das Kreuz ist Sklavenstrafe. Als der Spartakus-Aufstand niedergeschlagen war (71 v.Chr.), ließ Crassus die gefangenen Sklaven entlang der Via Appia zwischen Rom und Capua ans Kreuz schlagen. Das zur ewigen Warnung an alle, die es wieder wagen sollte, sich dem Imperium Romanum zu widersetzen und die ihm zukommende Stellung in Zweifel zu ziehen.
Das Kreuz ist Instrument der Siegerjustiz, angewandt gegen aufständische Sklaven – in den allermeisten Fällen waren das keine gebürtigen Römer. Wer gekreuzigt war, der war tot. Dessen Leichnam blieb in der Regel hängen, bis er von den Vögeln gefressen war, dessen Name wurde nicht mehr genannt. Der Gekreuzigte war tot: physisch tot und sozial tot. Sein Leben war ausgelöscht und auch die Erinnerung an ihn. Auch literarische Erwähnungen der Kreuzesstrafe sind spärlich. Worüber man nicht sprach, darüber schrieb man auch nicht. Die Evangelienberichte sind die ausführlichsten Schilderungen einer Kreuzigung, die uns aus der Antike überliefert sind.[4]
Es kann historisch kein Zweifel daran bestehen, dass Jesus von Nazareth genau diesen Kreuzestod gestorben ist. Das sagt viel darüber aus, wie die jüdischen und die römischen Eliten in Jerusalem: Kaiphas und Pontius Pilatus Jesu Leben gesehen und beurteilt haben. Das jüdische Urteil auf Gotteslästerung – angestoßen vermutlich durch Jesu Auftritt im Tempel von Jerusalem vor dem Pessach-Fest war im römischen Kontext nicht justiziabel. Der Kreuzestod deutet darauf hin, dass Pontius Pilatus in Jesus einen jüdisch-messianischen Verschwörer gesehen hat. Gegen einen solchen waren Folter und Kreuzestod angemessen. Keine weltbewegende Angelegenheit, nichts was die jüdische oder auch die römische Politik auch nur im Kleinsten verändert hätte.
Dieser Tod verlangt Antwort. Er steht in deutlichem Widerspruch zur Botschaft des Jesus von Nazareth vom nahen Reich Gottes. Im jüdischen Kontext gibt es zunächst erst einmal keine Verstehensmöglichkeit. Der leidende Gottesknecht aus dem Buch Deuterojesaja ist so kein Vorbild für den von Jesus erlittenen Fluchtod am Kreuz. Auch der Märtyrertod der Makkabäer ist ehrenvoll. Er fügt sich im Verständnis Israels ein in den apokalyptischen Horizont, in dem Israel seine Zeit als Endzeit beschreibt. Verflucht ist, der am Holze hängt – so heißt es im Buch Deuteronomium (21,23). Die einzig vorstellbare Reaktion auf diesen Tod ist Schweigen. Die Freunde Jesu haben in den Abgrund geblickt: Schweigen und zurück an die Arbeit; „Ich will fischen gehen“ – sagt Petrus (Joh. 21,13).
Die Freunde Jesu haben nicht geschwiegen. Von den Ostererfahrungen her haben sie den Tod Jesu gedeutet. Das Schweigen, die tiefe Depression hatte der Gekreuzigte selber überwunden, indem er sich als der Auferstandene gezeigt hatte. So fällt von Ostern her das Licht auf den Karfreitag. Von der Selbstoffenbarung des Auferstandenen her, wird es überhaupt erst möglich, vom Kreuz zu reden. Das schafft einen unlöslichen Zusammenhang zwischen Kreuz und der Auferweckung des Gekreuzigten. Dabei gilt, dass der Auferstandene wirklich die Nägelmahle des Gekreuzigten trägt, dass der Auferstandene also durch den Tod hindurch mit dem Gekreuzigten identisch ist. Das Interesse des Thomas, den Auferstandenen zu berühren, ist ein zutiefst theologisches Interesse. Karfreitag ohne Ostern führt in die theologische Sprachlosigkeit. Ostern ohne Karfreitag führt in die Schwärmerei. Die Identität des Gekreuzigten mit dem Auferstandenen Christus ist die Grundvoraussetzung und der Ausgangspunkt aller christlichen Theologie.
2. Der Tod am Kreuz ist mehrdeutig
Christliche Theologie beginnt damit, dass sie den Kreuzestod Jesu deutet. Der Deutungsrahmen, den sie dabei voraussetzt, bestimmt auch das spätere Ergebnis, die Kreuzestheologie. Dabei hat die christliche Theologie kein Deutungsmonopol für den Kreuzestod Jesu.
Die erste Deutung des Sterbens und des Todes Jesu geschieht durch jüdische Betrachter des Geschehens von Golgatha. Das aramäische Gebet des 22. Psalms (Eli, eli, lama asabtami) wird von den Passanten missverstanden. Sie denken, er ruft den apokalyptischen Propheten Elias, damit der Vorläufer des Messias ihn zum Ewigen geleite. Also verstehen sie Jesu Tod als Tod in Verzweiflung. Der Kreuzigungsbericht des Markus (Markus 15,37) legt eine solche Deutung ebenfalls nahe. Paulus spricht im 1. Korintherbrief nicht zufällig vom Skandal des Kreuzes (1.Korinther 1,18). "Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft". (Luther-Übersetzung)
Wenn das Wort vom Kreuz Torheit ist, dann ist es das Kreuz selbst erst recht, und dem Kreuzestod Jesu scheint für viele antike Zeitgenossen kein positiver Sinn beizumessen zu sein. Selbst die Auferstehung des Gekreuzigten kann sich im historisch Zweideutigen verlieren. Gottes Machttat gegen den Tod kann interpretiert werden als kriminelle Machenschaft der Jünger Jesu, um die Jesus-Bewegung auch nach dem Tod Jesu aufrecht zu halten. Nach der Grablegung wird die Bitte an Pontius Pilatus herangetragen: „Befiehl also, dass das Grab bewacht werde bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist von den Toten auferweckt worden. Der letzte Betrug wäre dann schlimmer als der erste.“ (Matthäus 27,64)
Christliche Kreuzestheologie bewegt sich auf dem Feld der mannigfaltigen Deutungen und Deutungsmöglichkeiten. Schon in den biblischen Texten selber werden sie vorgestellt und reflektiert. Christlicher Glaube hat sich von Anfang an mit unterschiedlichen Deutungen auseinanderzusetzen.
Die ersten Christen waren Juden – wie Jesus selbst. Ihr Horizont, das Leben und das Geschick des Jesus von Nazareth sind das Alte Testament, die Hebräische Bibel und die jüdischen Überlieferungen. Ihr Denken ist hebräisch geprägt. Ihr Glaube ist, dass der ewige Gott die Welt ins Dasein gerufen hat und dass er mittelbar und unmittelbar an der Welt handelt. Gott wird in der Geschichte erkennbar, nicht in der Idee. Hat die Geschichte des Jesus von Nazareth mit der Geschichte des ewigen Gottes zu tun, dann werden sich seine Spuren und seine Vor-Zeichen in der Hebräischen Bibel finden. Der erste Deutungsrahmen für den Kreuzestod Jesu ist die Hebräische Bibel. Aber auch dieser Deutungsrahmen ist keinesfalls eindeutig.
Die alttestamentlichen Vorbilder – oder besser: Anknüpfungspunkte für eine Deutung des Kreuzestodes Jesu sind nicht eben zahlreich.
a) Der Fluchtod am Kreuz – Paulus Gal. 3, 13
„Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist, und wird getötet und man hängt ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben — denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott -, auf dass du dein Land nicht unrein machst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt.“ (Dt.21,22,23) – Dieser Text rückt das Verständnis des Kreuzes sehr in die Nähe der antiken Konvention. Und wenn Paulus diesen Text im Galaterbrief zitiert, so geht er damit sicherlich auf umlaufende Deutungen des Kreuzestodes Jesu ein, um gerade diese negative Deutung im Sinne seiner Theologie positiv zu profilieren.
Das Kreuz ist Fluch, und Fluch ist mehr als eine menschliche Verurteilung. Fluch ist ein menschliches Urteil, das auf der Verwerfung Gottes selbst beruht. Fluch ist, was Gott durch sein Urteil ausgeschlossen hat. Das Kreuz ist Fluch, aber Gott hat – wider alle Erwartung und auch wider alle Theologie - den Fluch in Segen umgekehrt. Das Gesetz hatte die Menschen versklavt, der Kreuzestod Jesu ist wie der Loskauf aus dieser Sklaverei.
In seinem Kommentar zum Galaterbrief formuliert Heinrich Schlier: „Das Gesetz machte das Dasein aller Menschen zum Fluch. So hat Christus uns alle aus diesem verfluchten Dasein losgekauft.“ Dies sei aber in der Weise geschehen, dass er selbst zum Fluch geworden ist: „Eine Reflexion darüber, dass dies der Kaufpreis ist, wird durch solche Aussage nicht veranlasst, obwohl es natürlich den Sachverhalt trifft, wenn die Art und Weise, wie er uns loskaufte, zugleich als der Preis angesehen wird, um den er uns loskaufte, zugleich als der Preis angesehen wird, um den er uns loskaufte. Man kann den Tod Christi als die Kosten und als das Verfahren des Loskaufes der versklavten Welt bezeichnen“, so Schlier.[5]
b) der Tod des Gottverlassenen Psalm 22
Stilbildend für die Passionsberichte ist der Psalm 22. Hartmut Gese hat in einem Aufsatz 1973 gezeigt, dass die Passionsberichte der Evangelien durchgängig von diesem Psalm bestimmt sind. Claus Westermann hatte in der Auslegung des 22. Psalms von einer „gewendeten Klage“[6] gesprochen: Auf die Todesgefahr, ja das unmittelbare Hereinbrechen des Foltertodes, der Exekution, folgt die Wende, die das eschatologische Mahl im Kreise des Gottesvolkes heilvoll vor Augen stellt. Jahwe ist der Gott, der im Tode vom Tode errettet.
„In Ps 22 kommt also eine bestimmte apokalyptische Theologie zu Worte, die in der an einem Einzelnen sich vollziehenden Errettung aus der Todesnot die Einbruchstelle der basileia tou teou [Herrschaft/Reich Gottes] sieht: die Bekehrung der Welt, ausdrücklich mit dem basilea – Theologoumen begründet, die Auferstehung der Toten, wenn auch noch sehr zurückhaltend konzipiert als Erlösung zur kultischen Teilhabe an Jahwe, und die Verknüpfung dieser Heiltat in alle Zukunft.“[7]
Der Tübinger Alttestamentler Hartmut Gese fasst zusammen:
„Wir sehen: Die älteste Darstellung des zentralen Ereignisses des Todes Jesu wird verborgen unter dem Schleier von Ps 22. Damit werden wir hier nicht nur eine alte Interpretation des Todes Jesu vor uns haben, sondern, wie mir scheint, das älteste Verständnis des Golgathageschehens. Es ist hier nicht wie in Jesaja 53 vom Sühnopfer die Rede, ja noch nicht einmal vom Messias, sondern der zur tiefsten Leideserfahrung gesteigerte Tod Jesu führt mit ihm aus dem Tod herausrettenden Gotteshandeln zum Einbruch der eschatologischen basileia tou teou. Derjenige, der diese basileia in seinem Leben verkündet hat, führt sie in seinem Tod herbei.“[8]
c) der leidende Gottesknecht Jesaja 53
Ein weiterer alttestamentlicher Deutezusammenhang für das Verständnis des Todes Jesu ist das deuterojesajanische Gottesknechtslied Jes.53. Der „leidende Gerechte“, das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, scheint sehr der johanneischen Sprache verwandt. Es ist der Märtyrer, der um Gottes und der Menschen willen den Weg geht, der zum Tode führt. Stellvertretendes Leiden, die Übernahme fremden Geschicks durch den Knecht Gottes erscheint als eine Präfiguration des neutestamentlichen Bekenntnisses „Christus ist für uns gestorben!“ In seiner Auslegung des Gottesknechtsliedes schreibt Johannes Calvin:
„Christus war der Preis, der zur Abwehr der von uns verdienten Züchtigung gezahlt wurde. So wurde der Zorn Gottes gestillt, der mit Recht gegen uns entbrannt war. Friede wurde geschlossen durch den Mittler, so dass wir versöhnt sind. Daraus ist die allgemeine Lehre abzuleiten, dass wir umsonst mit Gott versöhnt werden, weil Christus den Preis unseres Friedens bezahlte. Zwar erkennt man das auch bei den Papisten, aber dann beschränkt man diese Lehre auf die Erbsünde, als ob es nach der Taufe keinen Raum für die Versöhnung aus Gnaden mehr gäbe, sondern der Mensch durch Verdienste der Heiligen und eigene Werke Gott genugtun müsse. Doch handelt der Prophet hier keineswegs nur von einem Teil der Erlösung, sondern bezieht sich auf das ganze Leben. Darum kann seine Lehre ohne Versündigung nicht eingeengt oder auf eine bestimmte Zeit beschränkt werden. Von hier aus ist es leicht, die von den Römischen erfundene Unterscheidung zwischen dem Erlaß der Strafe und der Schuld zu beseitigen: die Strafe, meinen sie, soll nur erlassen werden, wenn an ihre Stelle eine Genugtuung unsererseits tritt. Dagegen lehrt offenbar der Prophet, dass die Strafe für unsere Sünden auf Christus gelegt worden ist.“[9]
Für Johannes Calvin ist es ausgemacht, dass sich Jesaja 53 auf Christus bezieht, und es ist für ihn ebenso ausgemacht, dass Jes. 53 ein wichtiges Argument für die reformatorische Lehre des „sola gratia“ ist.
Was die Deutung des Kreuzestodes Jesu selbst angeht, äußert sich Calvin hier nicht. Der 2. Jesaja kennt den Fluchtod am Kreuz nicht. Es bleibt die Differenz zwischen dem Gott Israels und seinem Knecht. Es will scheinen, als sei Gott selbst nur mittelbar am Geschick dieses geplagten Menschen beteiligt, aber nicht so, dass ihn der Tod des Gerechten selber trifft bis ins Mark seiner Gottheit.
d) Christus, Hohepriester und Opfer zugleich – der Hebräerbrief
Für das abendländische Verständnis des Todes Jesu bestimmend ist die Opfertheologie geworden, wie sie vor allem im Hebräerbrief entfaltet wird. Es ist die Oper-Terminologie, die sich in der christlichen Kirche zur Deutung des Todes Jesu durchsetzen wird, und die auch das Verständnis des Abendmahls beherrscht. Das blutige Opfer der heidnischen Religion kommt – begründet durch das einmalige blutige Opfer Jesu am Kreuz – durch seine unblutige Widerholung allen Christen im Genuß des Heiligen Mahles zugute.
Christus aber, der als Hoher Priester der wirklichen Güter gekommen ist, ist durch das grössere und vollkommenere Zelt gegangen, das nicht von Menschenhand gemacht ist und also nicht zu dieser Schöpfung gehört.
Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat ewige Erlösung erlangt.
Wenn nun schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh Verunreinigte, die damit besprengt werden, heiligt — zur Reinigung des Fleisches —,
um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der durch ewigen Geist sich selbst als makelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen und uns zum Dienst am lebendigen Gott bereitmachen!
Darum ist er Mittler eines neuen Bundes: Sein Tod sollte geschehen zur Befreiung von den Übertretungen aus der Zeit des ersten Bundes, damit die Berufenen die Verheissung des ewigen Erbes empfangen. (Hebr.9,11-15)
Der Opfergedanke beruht darauf, dass die verletzte Gottheit durch die Gabe des lebendigen (Blut) versöhnt wird. Die beleidigte Gottheit kann nur durch die Hingabe des Lebendigen besänftigt werden. Die Opfertiere nehmen dabei eine Stellvertreterrolle ein. Eigentlich müssten die Menschen selbst mit ihrem Blut für die Beleidigung der Gottheit einstehen. In der liturgischen Bewältigungszeremonie nehmen die Tiere den Platz der Menschen ein, agieren und sterben schließlich stellvertretend für die Menschen.
Der klassische alttestamentliche Text für das stellvertretende Opfer ist die Beschreibung der Opfer des Grossen Versöhnungstages (Jom Kippur). Zwei Schafböcke werden vor den Hohepriester geführt. Einer wird geschlachtet und sein Blut wird zur Sühne auf den Altar gegossen. Der andere wird vor den Hohepriester geführt:
Und Aaron soll beide Hände auf den Kopf des lebenden Bocks legen und über ihm alle Schuld der Israeliten und all ihre Vergehen bekennen, mit denen sie sich versündigt haben. Und er soll sie auf den Kopf des Bocks legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste treiben lassen.
So soll der Bock all ihre Schuld mit sich forttragen in die Öde. Und der Mann soll den Bock in die Wüste treiben. (Lev. 16,21f.)
Das ist der sprichwörtliche „Sündenbock“, dem die Belastungen Israels zeichenhaft aufgelegt werden, ein christologisches Bild, das sich zur Deutung des Todes Jesu nahe legt. Es ist ein kultischer Deutezusammenhang, wie viele religiöse Deutezusammenhänge entweder mythische oder kultische Deutezusammenhänge sind. Kult ist eine Sprache der Religion. Kultische Sprache ist eine Möglichkeit, heilisgeschichtliche Zusammenhänge in gottesdienstlichem Rahmen verständlich zu machen. Der Zusammenhang des kultisch im Opfer vergossenen Blutes mit dem blutigen Kreuzestod Jesu ist evident.
Im Kontext des Neuen Testaments wird man sagen müssen, dass die Opferterminologie eine, aber doch nur eine Möglichkeit ist, den Tod Jesu theologisch angemessen zur Sprache zu bringen.
Die historisch erkennbare Kreuzigung des Jesus von Nazareth und seine im Glauben erkannte und erfahrene Auferweckung durch den lebendigen Gott eröffnet gerade auf dem Hintergrund der Überlieferungen des Volkes Israel unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten. Der leidende Gerechte steht neben dem von Gott verlassenen und letztlich von demselben Gott gerechtfertigten, der geopferte Hohepriester, der selber zum Opfer wird, steht neben dem Lamm, das geschlachtet wurde und dem nun Ehre und Macht und Hoheit und Preis und Gewalt zukommen.
3. Das klassische Verständnis des Todes Jesu bei Anselm von Canterbury
Mit dem Namen und mit der Theologie des Anselm von Canterbury verbindet sich die Deutung des Todes Jesu, die man gemeinhin als Satisfaktionstheologie bezeichnet. In seiner Schrift „Cur deus homo?“ (1094-1908) entfaltet Anselm die Lehre von der Satisfaction Gottes. Durch die Sünde ist das Verhältnis Gottes zu seiner Schöpfung – und vor allem zu dem von ihm geschaffenen Menschen - zerstört. Sünde tastet die Ehre Gottes an. Und die Ehre Gottes kann nicht anders wiederhergestellt werden, als dass eine entsprechende Strafe gezahlt wird:
„Also ist es notwendig, dass entweder die geraubte Ehre wiederhergestellt wird, oder Strafe folge. Sonst ist entweder Gott gegen sich selber nicht gerecht oder er ist zu beidem unfähig, was auch nur zu denken ein Frevel ist.“[10]
Daß Gott trotz dieser tiefen Verfehlung sich überhaupt mit dem Gedanken trägt, sich den Menschen wieder zuzuwenden, liegt für Anselm daran, dass Gott die beim Engelsturz verlorenen Engel durch Menschen ersetzen will. Das gelingt aber nicht, ohne dass für die Sünde der Menschen Genugtuung geleistet wird. Nach langen Gesprächsgängen kommt Anselm zu dem Schluß, dass wirkliche Sühne nicht der Mensch selber leisten kann, sondern nur der Gott-Mensch, der selber ohne Sünde ist, und der so die Sünde der Vielen auf sich nehmen kann.
„Der Kernpunkt der Frage war: warum Gott Mensch geworden ist, so dass er durch seinen Tod den Menschen rettete, da er es doch augenscheinlich auf andere Weise hätte tun können. Worauf du in deiner Antwort mit vielen und zwingenden Gründen gezeigt hast, dass die Wiederherstellung der menschlichen Natur nicht unterbleiben durfte und dass sie nicht geschehen konnte, wenn der Mensch nicht einlöste, was er Gott für die Sünde schuldig war. Diese Schuld war so groß, dass sie, obwohl sie nur der Mensch einlösen musste, es nur Gott konnte, so dass derselbe Mensch wie Gott war. Daher war es notwendig, dass Gott den Menschen in die Einheit der Person aufnahm, damit der, der der Natur nach einlösen musste und nicht konnte, der Person nach wäre, der es konnte. Ferner hast du aufgezeigt, dass jener Mensch, der Gott war, aus der Jungfrau und von der Person des Sohnes Gottes angenommen werden musste und wie er ohne Sünde aus der sündigen Masse angenommen werden konnte. Du hast aber aufs klarste bewiesen, dass das Leben dieses Menschen so erhaben, so kostbar sei, dass es hinreichen kann, zur Erlösung dessen, was für die Sünden der ganzen Welt geschuldet wird, und für noch unendlich mehr.“[11]
Und auf die Frage, warum Gott diesen Weg zur Erlösung der Menschen gehen musste, antwortet Anselm mit dem berühmten Satz: Nondum considerasti, quanti ponderis sit peccatum – du hast noch nicht erwogen, von welcher Schwere die Sünde ist.[12]
An der Satisfaktionlehre des Anselm von Canterbury überzeugt seine scheinbare Logik. Sünde und Sühne werden gegeneinander aufgewogen. Die Tat des Gottmenschen am Kreuz heilt die Wunde, die seit den ersten Tagen das Verhältnis der Menschen zu Gott vergiftet hat. Aber genau das, was über Generationen hinweg und auch quer durch die Konfessionen als schlüssig empfunden worden ist, ist auch die Schwäche dieses Entwurfes. Es hat den Eindruck, als sei es das Prinzip der Sühne, das hier das Handeln Gottes in Christus bestimmt. Es hat den Anschein als sei die Sünde der Motor der Geschichte, der das Handeln Gottes in der Geschichte überhaupt erst provoziert. Welche ethischen Folgen solche Sühne-Theologie nach sich zieht, ist nicht schwer zu erraten.
4. Die trinitarischen Schwierigkeiten der Rede vom Tode Jesu
Der Tod des Sohnes Gottes am Kreuz bleibt nicht ohne Folgen für Gott selbst. Der Tod des Sohnes Gottes berührt Gott selbst. Wenn Jesus stirbt, stirbt Gott. Die Gnostiker haben einen Ausweg aus diesem denkerischen Dilemma gefunden, indem sie Jesus von Gott im Moment seines Todes getrennt haben. Gottes Sohn stirbt – oder jemand, der so aussah wie Gottes Sohn, aber Gott selbst bleibt in seiner Majestät, in seiner Hoheit, in seiner Ewigkeit und seiner Unsterblichkeit unangetastet von dem, was auf Golgatha geschehen ist.
Die Frage „Was hat der Tod Jesu mit Gott zu tun?“ ist eine trinitarische Frage und eine Frage, die der christlichen Theologie aufgegeben bleibt. Was bedeutet der Tod des Sohnes Gottes für die metaphysischen Attribute Gottes? Was bedeutet der Tod Jesu für die Unsterblichkeit Gottes, für seine Barmherzigkeit, für seine Gnade, für seine Unbewegtheit? Oder umgekehrt: was bedeutet es, wenn der Tod, die Vernichtung allen Lebens in Gott selbst eingezeichnet ist? Der Tod Gottes steht zwischen Vater und Sohn. Der Tod Gottes berührt die Wirkung des Heiligen Geistes. Der Tod Gottes ist der Tod aller metaphysischen Bestimmungen.
Treffend formuliert Werner Thiede in seinem Buch „Der gekreuzigte Sinn“:
„Darum sollte theologisch nicht länger bezweifelt werden: Der Gott der Christenheit ist ein leidensfähiger Gott. Das muß klar sein gegenüber mancherlei metaphysischen oder religiösen, ab und an auch innerhalb des Christentums anzutreffenden Auffassungen, die Gottes Natur als wesenhaft leidensfrei, ja, leidensunfähig definieren, also als vollkommen erhaben gegenüber der endlichen, vergänglichen Welt. Richtig daran ist im Grunde das Gespür dafür, dass der Begriff Gottes den der Vollkommenheit einschließen muß. Übersehen wird hier indessen völlig, dass es zur Vollkommenheit der Liebe, die Gott ist, gehört, sich selbst zu transzendieren aufs Nichtgöttliche, Unvollkommene hin – mit allen schmerzlichen Konsequenzen des Sich-Einlassens auf dieses Andere.“[13]
Gott und Tod sind in der Geschichte der Liebe Gottes aufgehoben. Wer Gott und den Tod nicht zusammen sieht, der redet nicht von dem lebendigen Gott. Wer den Tod aus Gott selbst ausblendet, hat von christlichem Glauben und christlicher Theologie nichts verstanden. Im Kreuz Jesu ist das Undenkbare Wirklichkeit geworden. Ganz vereinzelt finden sich in der christlichen Tradition Spuren dieser Erkenntnis.
O große Not! Gott selbst ist tot,
Am Kreuz ist er gestorben,
Hat dadurch das Himmelreich
Uns aus Lieb' erworben.
Johann Rist 1741
Sachgerecht vom Tode Jesu am Kreuz reden heißt: Vom Tode Gottes reden. Das Kreuz Jesu verändert die Rede von Gott. Die Auferweckung des Gekreuzigten macht deutlich, dass der Tod Jesu nicht das Ende des Erwählten Gottes ist, nicht das Ende Gottes selbst. Dennoch kann man nach Karfreitag und Ostern nie wieder so von Gott reden, wie es die griechischen Philosophen getan haben. Nie wieder kann man Gott mit den klassischen Gottesattributen beschreiben: unendlich, unnahbar, unverwundbar, unendlich, unweltlich, unbeschreiblich.
Seit Karfreitag und Ostern kann man Gott nur mit seiner Geschichte erzählen und erinnern: mit dem Leiden, mit dem Kreuz aber auch mit dem Ostermorgen. Das Kreuz ist in die Trinität eingezeichnet. Das Kreuz ist die Krise aller allgemeinen Gottesbegriffe, aller natürlichen und gefühlten Theologien. Von Gott reden heißt: Vom Kreuz Christi reden. Es heißt: von der Jahrhunderte langen Judenverfolgung und Judenvernichtung reden, es heißt: von Auschwitz reden und von Treblinka, von Srebrenica.
Immer wieder wird in diesem Zusammenhang ein Abschnitt aus dem Buch „Nacht“ des jüdischen Nobelpreisträgers Elie Wiesel zitiert. Auch wenn es gewiß nicht die Absicht des Juden Wiesel war, christologisch zu reden. Man kann sich der christologischen Dimension seiner Erzählung nur schwer entziehen.
"Wo ist Gott?
Die SS schien besorgter, beunruhigter als gewöhnlich.
Ein Kind vor Tausenden von Zuschauern zu hängen, war keine Kleinigkeit. Der Lagerchef verlas das Urteil. Alle Augen waren auf das Kind gerichtet. Es war aschfahl, aber fast ruhig und biss sich auf die Lippen. Der Schatten des Galgen bedeckte es ganz.
Diesmal weigerte sich der Lagerkapo (Häftling, der für „schmutzige Arbeit" Vergünstigungen erhielt), als Henker zu dienen. Drei SS-Männer traten an seine Stelle.
Die drei Verurteilten stiegen zusammen auf ihre Stühle. Drei Hälse wurden zu gleicher Zeit in die Schlingen eingeführt. „Es lebe die Freiheit!" riefen die beiden Erwachsenen. Das Kind schwieg. "Wo ist Gott, wo ist er?" fragte jemand hinter mir. Auf ein Zeichen des Lagerchefs kippten die Stühle um. Absolutes Schweigen herrschte im ganzen Lager. Am Horizont ging die Sonne unter. „Mützen ab!" brüllte der Lagerchef. Seine Stimme klang heiser. Wir weinten. „Mützen auf!" Dann begann der Vorbeimarsch. Die beiden Erwachsenen lebten nicht mehr. Ihre geschwollenen Zungen hingen bläulich heraus. Aber der dritte Strick hing nicht reglos: der leichte Knabe lebte noch.
Mehr als eine halbe Stunde hing er so und kämpfte vor unseren Augen zwischen Leben und Sterben seinen Todeskampf. Und wir mußten ihm ins Gesicht sehen. Er lebte noch, als ich an ihm vorüberschritt, seine Zunge war rot, seine Augen noch nicht erloschen. Hinter mir hörte ich denselben Mann fragen: „wo ist Gott?" Und ich hörte eine Stimme in mir antworten: „Wo ist er? Dort – dort hängt er am Galgen ..."
An diesem Abend schmeckte die Suppe nach Leichnam.“[14]
Am Kreuz Jesu sind Gott und der Tod unlöslich beieinander (Michael Welker). Ostern ist die Auferweckung des Gekreuzigten, das Ja Gottes zum Leben gegen den selbst erfahrenen Tod. Ostern ist der Vorschein dessen, dass Gott sein wird alles in allen (1.Kor.15,28)
5. Opfer Gottes oder Gott für uns
Gott muß durch Opfer besänftigt werden. Das ist allgemein religiöse Erkenntnis, ein Deuterahmen, der das christliche Verständnis des Todes Jesu immer wieder bestimmt hat und noch bestimmt. Der Zorn Gottes verlangt Opfer, damit Gott wieder gnädig gestimmt wird. Das Vergehen gegen Gott will Blut sehen. Nur wenn Blut fließt, ist Gott geneigt, sich den Menschen wieder zuzuwenden. Das Christentum bietet den Extremfall: Nur wenn Gottes Sohn sein Blut opfert, wird Gott besänftigt. Gott will Blut sehen – zur Not das Blut seines eigenen Sohnes. Gott ist ein blutrünstiger Gott. Nur wenn Blut fließt, gibt es Gnade. Nur wenn der Sohn Gottes sein Leben lässt, haben die, die dem Sohn Gottes folgen, eine Chance. Blut ist das Mittel der Versöhnung. Blut ist ein ganz besonderer Saft (Goethe, Faust). Und dieses Blut muss notwendig fließen, damit die Welt in Ordnung kommt.
„Ich brauche es nicht, dass jemand für mich stirbt!“ – sagt die junge Lehrerin in einem Gespräch, in dem es um die Bedeutung Jesu von Nazareth geht. Für sie ist es eine Kränkung der eigenen Person und auch der eigenen moralischen Qualität, dass man ihr sagt: du bist nur gut, wenn du anerkennst, dass ein anderer für dich gestorben ist. Die Lehrerin spricht nur aus, was die meisten unserer westeuropäischen Zeitgenossen denken: „Ich bin OK – Du bist OK“. In meine Beziehungen brauche ich keine Einmischung eines Dritten. Die Karfreitagsfrömmigkeit der Evangelischen Kirche hat nur dazu geführt, dass ich ein schlechtes Gewissen bekommen habe, dass man mir eingeredet hat, ich habe Jesus verletzt, zu seiner Kreuzigung beigetragen:
Ich bin’s, ich sollte büßen,
an Händen und an Füßen
gebunden in der Höll.
Die Geißeln und die Banden,
und was du ausgestanden,
das hat verdienet meine Seel.
Paul Gerhardt 1647 (EG 84,3)
Aber ich war nicht in Golgotha. Ich habe nicht im Hof der Burg Antonia gestanden und gerufen „kreuziget ihn!“ Das Leben Jesu ist längst vergangenes Leben. Sein Tod war Tod vor meiner Zeit. Zwischen ihm und mir liegt der „garstige Graben“ der Geschichte, von dem Lessing spricht. Was zieht mich in diesen Tod? Was verbindet mich mit diesem Leiden? Was geht mich die Schuld der Hohepriester an, was die Schuld des Pilatus, was die Schuld derer, die „Kreuzige ihn!“ geschrieen haben?
Die Frage ist: Braucht Gott Blut, um mit sich selbst ins Reine zu kommen? Und die Zusatzfrage schließt sich gleich an: Brauchen die Menschen Blutopfer, um sich selbst behaupten zu können? Befürworter der Todesstrafe argumentieren in diese Richtung. „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (Ex 21,24) „Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschenhand vergossen werden“ (Gen.9,6). Im alttestamentlichen Verständnis ist Blut der Sitz des Lebens. Wer Blut vergießt, der zerstört Leben. Wer Leben zerstört, hat das durch sein eigenes Blut zu sühnen. Schon das Alte Testament kennt den Ersatz, das Tieropfer. Aber immer noch heißt es: Leben gegen Leben, Blut für Blut. Muss Gott mit Blut für die Sünde der Menschen versöhnt werden? Ist die Verletzung, die Gott durch die Sünder der Menschheit und jedes einzelnen Menschen davongetragen hat, so stark, dass er das vergossene Blut braucht, um sich der Welt und den Menschen wieder zuwenden zu können?
6. Versöhnung
In der Sprache der Theologie bedeutet „Versöhnung“, dass die schuldbeladene Geschichte des Menschen mit Gott in Ordnung kommt. Versöhnung bedeutet, dass trotz allem, was gewesen ist, sich ein neuer Anfang eröffnet, eine heilvolle Perspektive ersichtlich wird. Kein Streit mehr zwischen Gott und Mensch, kein schlechtes Gewissen auf Seiten des Menschen, keine Angst vor der Zukunft und keine Angst mehr vor dem Tod, keine Furcht vor den Folgen der vergangenen Schuld. Keine Furcht davor, dass mich die Geschichte versäumter Gelegenheiten hinterrücks einholt.
Leben in der Perspektive der Zukunft, Leben auf Hoffnung hin, auf das unbeschädigte Leben in dem alles zu seinem Recht kommt und alle das ihre empfangen. Leben auf Barmherzigkeit hin. Leben aus Gnade, die nicht Herablassung bedeutet, sondern Leben, wie es von Anbeginn der Zeit an gewollt war. „An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen“ sagt Jesus – (Joh. 16,23). Das mag das Ziel des Lebens sein: Das Ziel individuellen Lebens und zugleich das Ziel des gemeinschaftlichen, kollektiven Lebens.
Cilliers Breytenbach hat in seiner Studie „Versöhnung – eine Studie zur paulinischen Soteriologie“ herausgearbeitet, dass bei Paulus weniger der Opfergedanke als vielmehr das Versöhnungegeschehen Gottes im Mittelpunkt seiner Christologie steht. Gott bringt das, was sich getrennt hat, wieder zusammen. Er schließt den Graben zwischen dem Menschen , der sich von ihm entfernt hat und sich selbst. Gott tut das nicht, weil er es brauchte, noch gar weil er Blut brauchte. Nicht Gott muss versöhnt werden, sondern der von ihm getrennte Mensch, der sich zudem dieser Versöhnung mit allen Mitteln widersetzt. „Denn ich bin gewiss: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat.“ (2.Kor. 5,19).
In der Geschichte des Jesus von Nazareth identifiziert sich der lebendige Gott mit dem von ihm entfernten Menschen. Er zieht damit alles Verkehrte, alle Bosheit und Gewalt auf sich: „Der von keiner Sünde wusste, wurde von uns zur Sünde gemacht!“ (2.Kor.5,21). Die Last, die kein Mensch länger tragen konnte, hat Gott selbst an seiner Stelle auf sich genommen: „Fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre.“ (Jes.53)
Die causa crucis ist nicht die Vergeltungssucht Gottes – es ist die abgrundtiefe Verkehrtheit der Welt. Nondum considerasti quanti ponderis sit peccatum!
7. Aus Liebe will mein Heiland sterben
Er hat uns allen wohlgetan,
Den Blinden gab er das Gesicht,
Die Lahmen macht er gehend,
Er sagt uns seines Vaters Wort,
Er trieb die Teufel fort,
Betrübte hat er aufgericht',
Er nahm die Sünder auf und an.
Sonst hat mein Jesus nichts getan.
Aus Liebe,
Aus Liebe will mein Heiland sterben,
Von einer Sünde weiß er nichts.
Dass das ewige Verderben
Und die Strafe des Gerichts
Nicht auf meiner Seele bliebe.
Mit diesem Rezitativ und dieser Arie deutet Johann Sebastian Bach in seiner Matthäuspassion den Tod Jesu als Liebesbeweis Gottes für die Welt, die sich selbst in den Abgrund gebracht hat. Es gibt keinen äußeren Grund für Gott, die Welt nicht zum Teufel gehen zu lassen – sie eigentlich nur sich selber zu überlassen. Es gibt keinen äußeren Grund, dass Gott sich selbst bis zur Selbstaufgabe in die inneren Angelegenheiten der Welt einmischt, sich von ihr schlagen, verspotten, verhöhnen und kreuzigen lässt als nur die Liebe, die Gott vor aller Zeit in sich selber war als Vater, Sohn und Geist, die sich entäußerte, als Gott die Welt ins Leben rief, als er sich sein Volk erwählte und bewahrte, als er selber zur Welt kam – nicht als Herr, sondern als Knecht, ganz unten im Stall bei Hirten und Schafen. Und er geht durch das Leben – der allen Anspruch auf Herrschaft geltend machen könnte – als jüdisches Kind, als jüdischer Mensch. Er geht zu denen, die im Lichte stehen, aber vor allem sucht er die Schattenmenschen, die Blinden und Aussätzigen, die sich selbst durch ihre Schuld außerhalb der Gesellschaft gestellt haben.
Um Gottes Willen gerät er in den Konflikt mit den Gottesgelehrten. Der Streit um den Tempel wird zum Streit um sein Leben. „Wir sollen nicht, dass dieser über uns herrsche!“ – sagen die Knechte im Gleichnis von den bösen Weingärtnern (Lukas 19,14). Aber er geht seinen Weg weiter, bis sich die jüdischen und die römischen Autoritäten in Jerusalem einig sind, ihn aus dem Weg zu schaffen. Man überlässt ihn der folternden Soldateska und lässt ihn den Sklaven- und Rebellentod sterben. Das ist nicht der Wille Gottes, dass es so geschieht – das ist das wahre Gesicht er Welt du der Menschen. So sind sie, dass sie sich selbst an Gott austoben. Sie sind schranken- und grenzenlos! Und Christus geht diesen Weg – aus Liebe. Auch in der tiefsten Tief zeigt er, wer Gott in Wirklichkeit ist: Liebe. Es gibt keinen Neuanfang durch Gewalt – der wird auch wieder in Gewalt enden. Der Neuanfang Gottes mit der Welt beginnt und endet in der Liebe. Und wer hinter der Liebe Gottes eine andere Macht, eine andere Absicht vermutet, der entfernt sich mehr oder weniger vom biblischen Zeugnis.
Besonders deutlich wird diese Sicht auf die Passion Jesu in der Deutung des Johannesevangelium, das von Anfang an deutlich macht, dass hier der Herr es ist, der zum Kreuz geht: vor ihm weichen die Soldaten zurück und fallen zu Boden (Johannes 18,6), im Verhör wird die Unschuld Jesu erwiesen (Johannes 18,23), der Dialog mit Pilatus erweist die Hoheit Jesu (Johannes 18,36f.), auch Pilatus findet keine Schuld an ihm (Johannes 18,38), die Dornenkrone ist die Persiflage der Königskrone (Johannes 19,2), Jesus trägt seinen Kreuzesbalken allein (Johannes 19,17), der Kreuzes Titulus offenbart, wer Jesus ist (Johannes 19,19), und natürlich das letzte Wort Jesu „Es ist vollbracht.“ (Johannes 19,30).
Trotz aller Grausamkeit ist es eben doch kein blindes Schicksal, das Jesus widerfährt. Der Herr ist es, der zum Kreuz geht. Von niemandem gezwungen, von keinem Menschen oder von keiner Situation genötigt. Er geht zum Kreuz: aus Liebe! Aus keinem anderen Grund! Von Ostern her wird deutlich, dass der Weg Jesu zum Kreuz der Weg der Versöhnung Gottes mit der Welt gewesen ist. Ein Weg, der keine menschliche Tiefe ausspart, der selbst den Tod durchschreitet, damit die Menschen auch im Tode nicht gottverlassen sind.
Treffend fasst Wilfried Härle die Bedeutung des Todes Jesu zusammen, wenn er schreibt:
„Die Heilsbedeutung des Todes Jesu Christi besteht darin, dass von Gott her Vergebung, Versöhnung, Befreiung, neues Leben zugesagt und gestiftet wird. Das erreicht dort sein Ziel und kommt zur Wirkung, wo Menschen ihren Glauben, d. h. ihr Vertrauen im Leben und im Sterben auf den Gott richten, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat und sich ihnen so zuwendet.
Die menschliche Sünde und Bosheit, die die von Gott gegebene heilsame Ordnung des Lebens verletzt und zerstört, ist eine Realität, die verarbeitet und durchlitten werden muss, wenn das Böse nicht bagatellisiert oder verdrängt werden soll. Das Kreuz Jesu Christi steht für die ‚Arbeit’, und ‚Mühe’ die wir Gott mit unseren Sünden machen, die Gott um seinetwillen tilgt und ihrer nicht mehr gedenkt (Jes 43,24f.). Und damit steht das Kreuz Jesu Christi für die göttliche Möglichkeit und Wirklichkeit, dass Böses mit Gutem vergolten werden kann, „damit wir Frieden hätten“ (Jes 53,5).“[15]
Philipper 2,6-11
6 Er, der Gott in allem gleich war
und auf einer Stufe mit ihm stand,
nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus.
7 Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte
und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener.
Er wurde einer von uns -
ein Mensch wie andere Menschen.
8 Aber er erniedrigte sich ´noch mehr`:
Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich;
er starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`.
9 Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht
und hat ihm ´als Ehrentitel` den Namen gegeben,
der bedeutender ist als jeder andere Name.
10 Und weil Jesus diesen Namen trägt,
werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen,
alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind.
11 Alle werden anerkennen,
dass Jesus Christus der Herr ist,
und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben.
(Neue Genfer Bibelübersetzung)
--------------------------------------------------------------------
1. Burkhard Müller, Rundfunkandacht am 10.2.2009 WDR 5, http://www.chrismon-rheinland.de/cpr/docs/mueller_andachten.pdf
[2]. Andre Schwarz-Bart, Der letzte der Gerechten, Berlin 1963, S.368f.
[3]. Wolfgang Bauer, Irmtraud Dümotz, Sergius Golowin, Lexikon der Symbole, Wiesbaden, 21.Auflage 2006, S.203f.
[4]. Martin Hengel, Mors turpissima crucis in: Rechtfertigung FS Käsemann, Tübingen 1976, S.125-184
[5]. Heinrich Schlier, Der Brief an die Galater, KEK NT , Göttingen 5.Auflage 1971, S.137.
[6]. Claus Westermann, Ausgewählte Psalmen, Göttingen 1984, S.64.
[7]. Hartmut Gese, Psalm 22 und das Neue Testament in: Hartmut Gese, Vom Sinai zum Zion, Alttestamentliche Beiträge zur biblischen Theologie, München 1973, S.192.
[8]. Gese ebd. S.196.
[9] Johannes Calvin, Auslegung der Heiligen Schrift, 7. Band, Der Prophet Jesaja, 2.Hälfte, S.287f.
10. Anselm von Canterbury, Cur deus homo?, I, 14.
[11]. Anselm ebd. II, 18 S.143, Summa quaestionis fuit cur deus homo factus sit, ut per mortem suam salvaret hominem, cum hoc alio modo facere portuisse videretur. Ad quod tu multis et necessariis rationibus respondens ostendisti restaurationem humanae naturae non debuisse remanere, nec potuisse fieri, nisi solveret homo, quod deo pro peccato debeat. Quod debitum tantum erat, ut illud solvere, cum non deberet nisi homo, non posset nisi deus, ita ut idem esset homo qui deus. Unde necesse erat, ut deus hominem assumeret in unitatem personae, quatenus qui in natura solvere debebat et non poterat, in persona esset qui posset. Deinde quia de virgine et a persona filii die esset assumendus homo ille qui deus esset, et quomodo sine peccato de
[12]. Anselm ebd. I,21 S.75
[13].Werner Thiede, der gekreuzigte Sinn – eine trinitarische Theodizee, Gütersloh 2007, S.171.
[14].Elie Wiesel, Die Nacht zu begraben ..., 1986, (Seite 93/94)
15. Wilfried Härle, „...gestorben für unsere Sünden“ Die Heilsbedeutung des Todes Jesu Christi, (2007) http://www.w-haerle.de/Gestorben%20fuer%20unsere%20Suende.pdf
Domprediger Pfr. Martin Filitz, Halle, den 28.August 2010